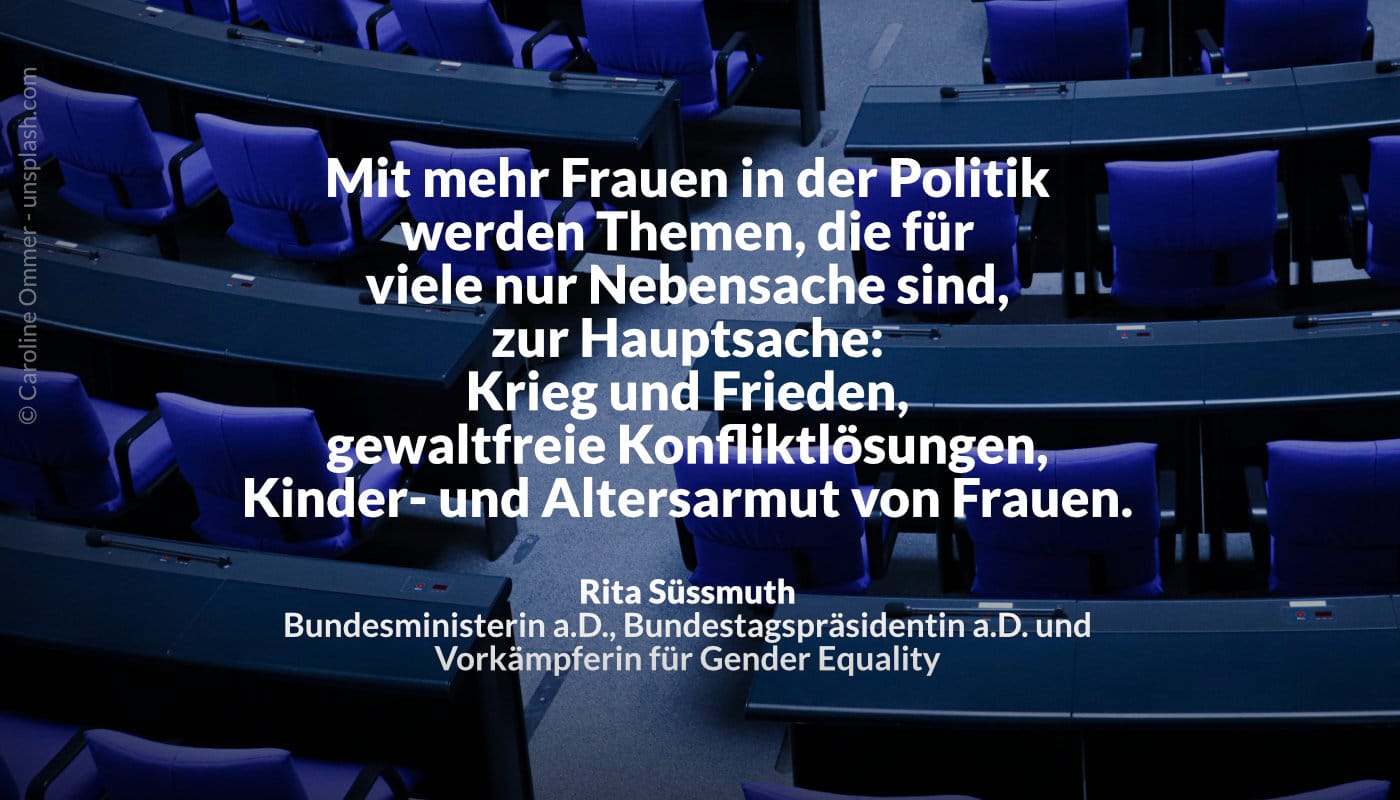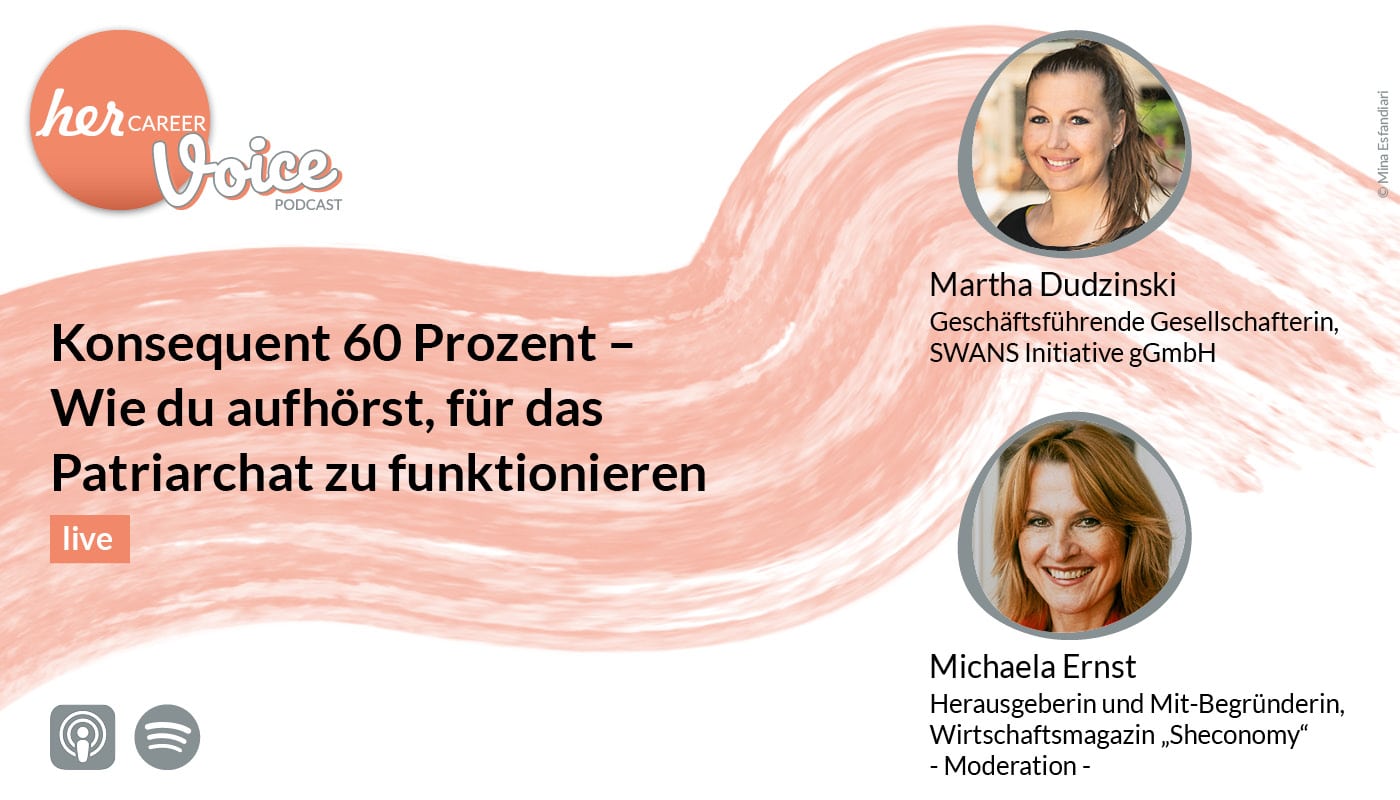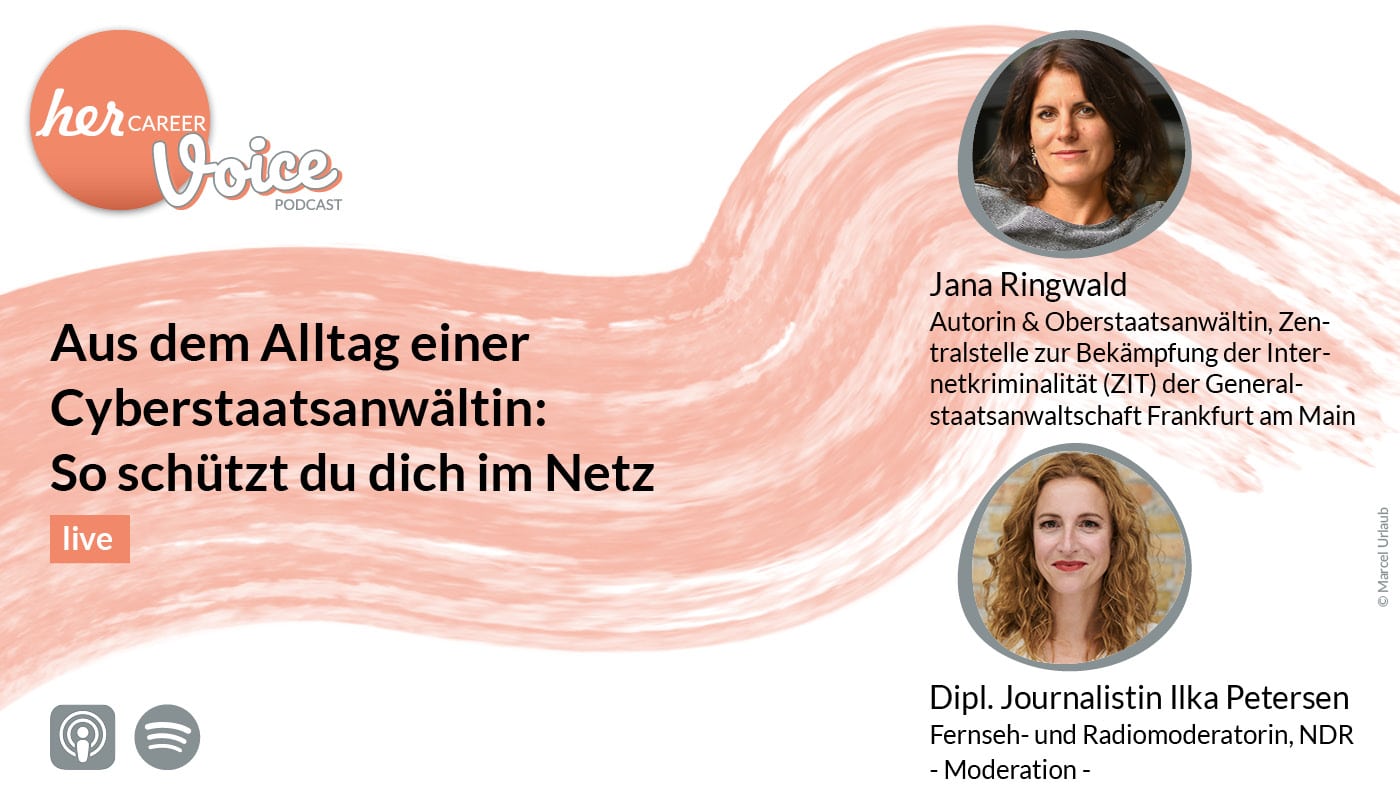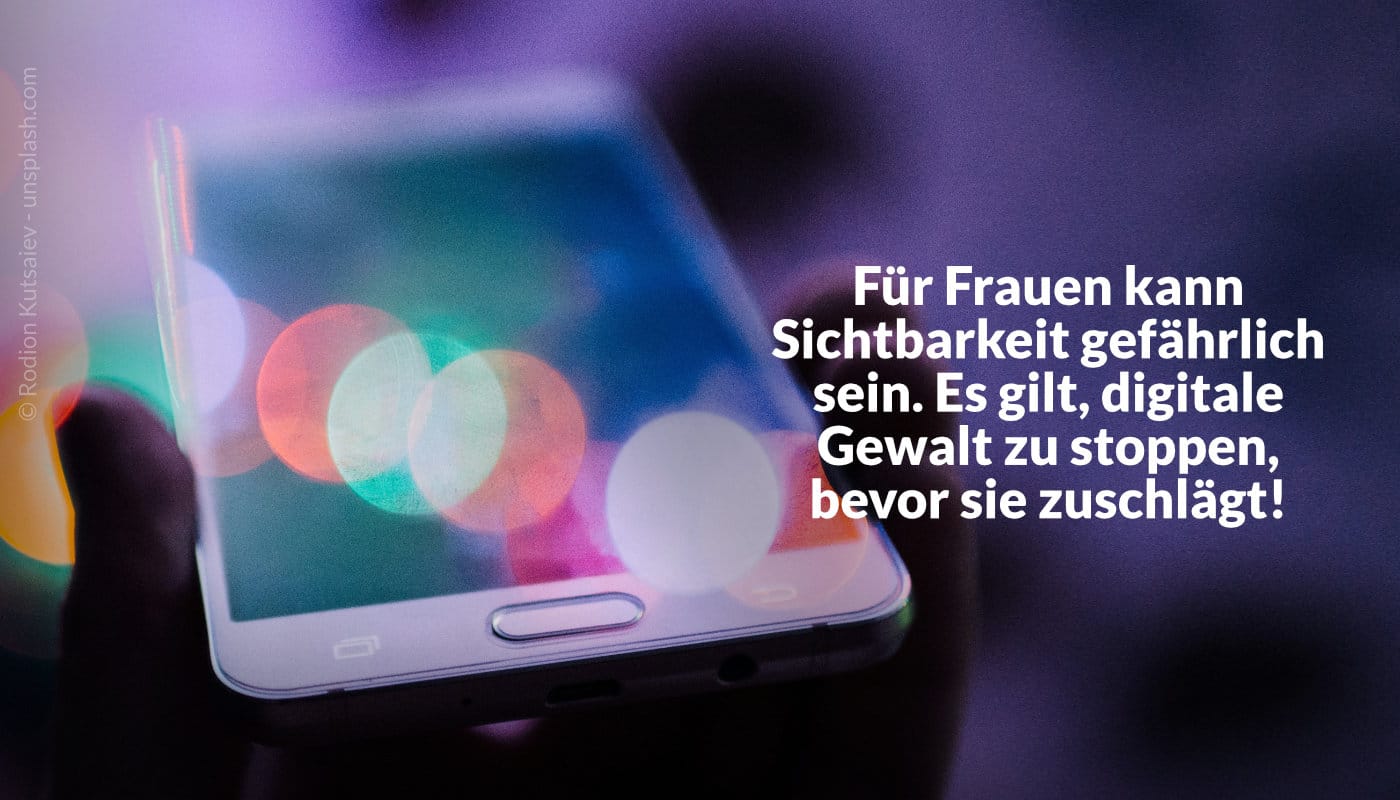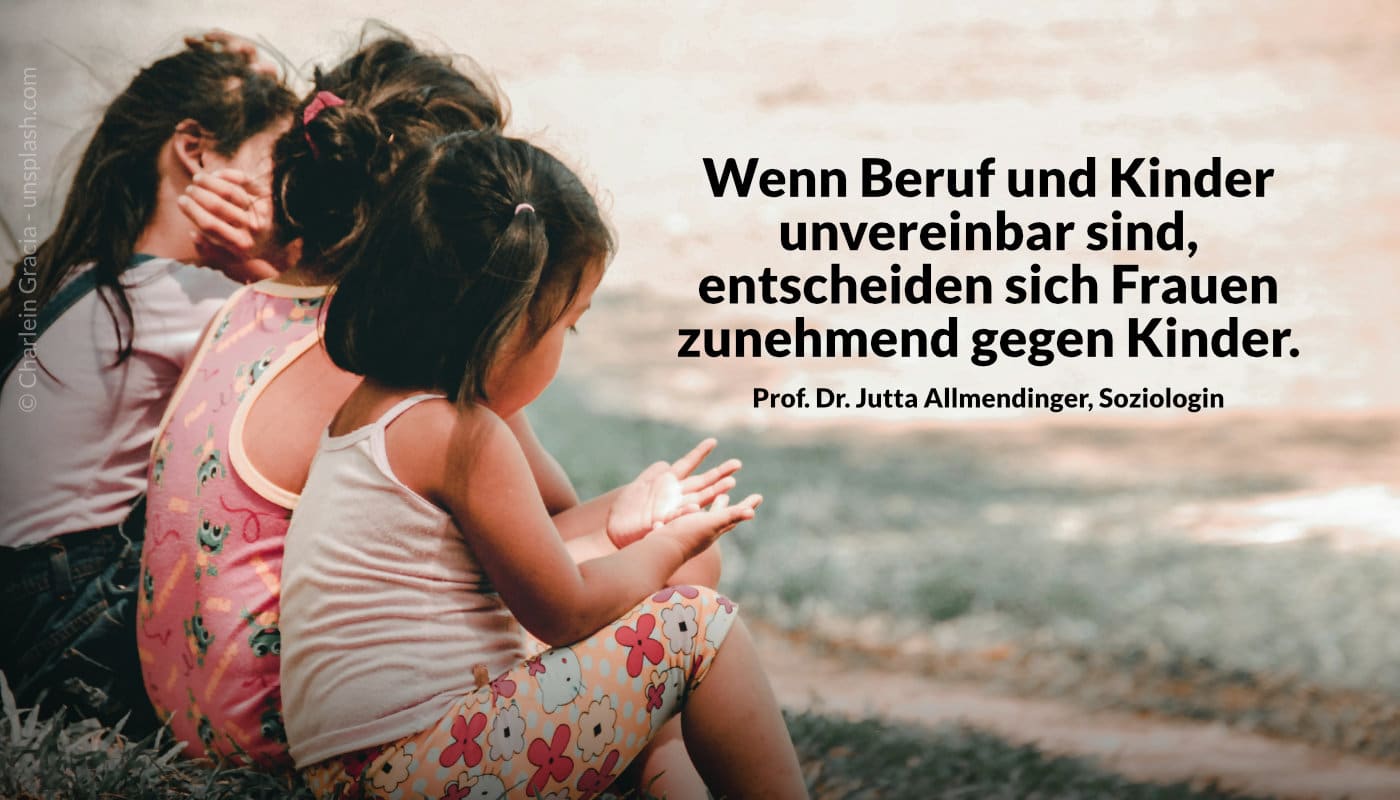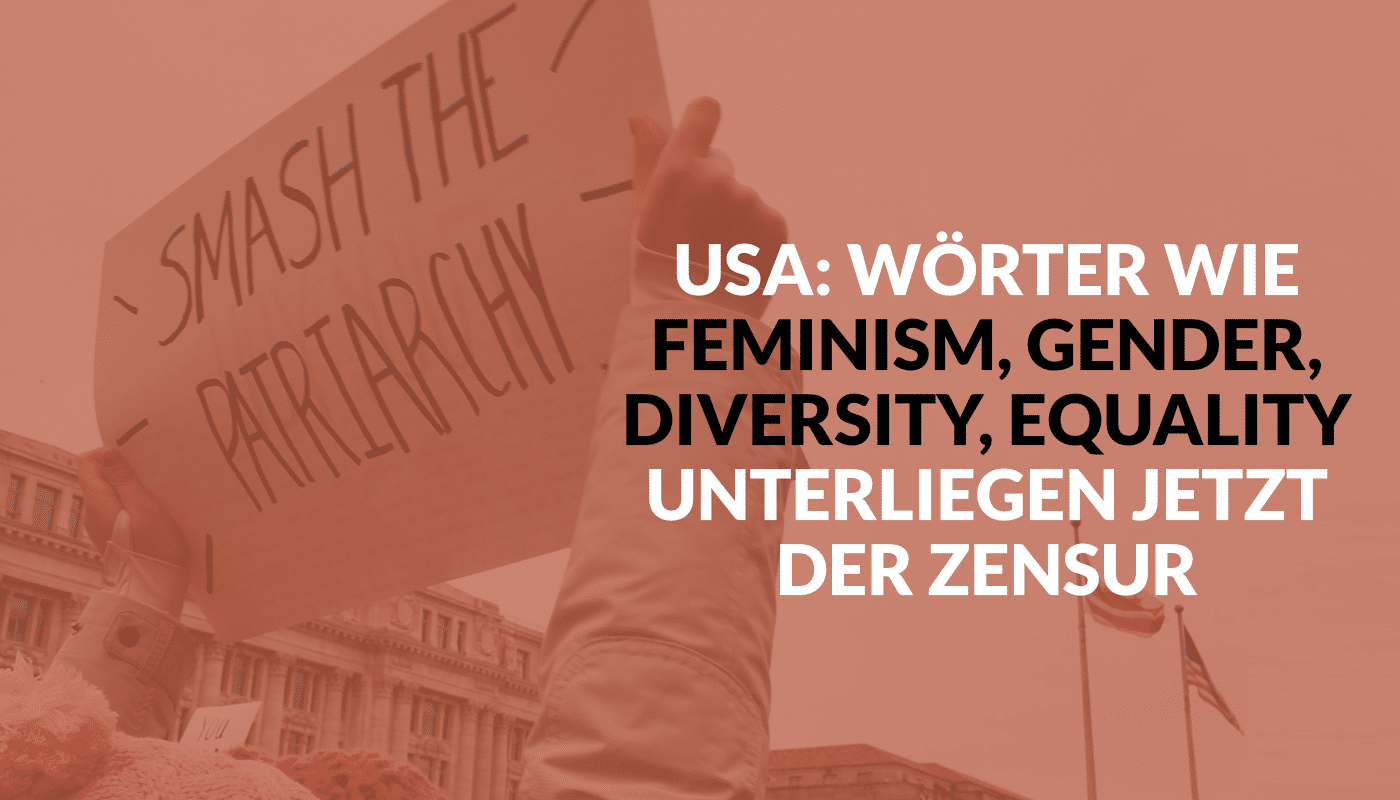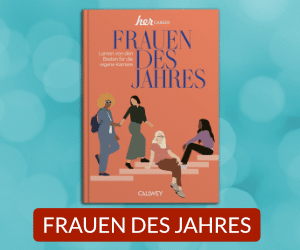Woran denkst du, wenn du Diversity, Equity und Inclusion (DE&I) hörst? An Hautfarbe? Religion? An Gender? Oder vielleicht an soziale Herkunft? Wenn ja, dann bist du Thema dieser Folge: Klassismus
Dr. Francis Seeck, Professor:in für Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Demokratie und Menschenrechtsbildung, ist eine der wichtigsten Stimmen in der deutschen Debatte über Klassismus und forscht sowie lehrt zu Klassismuskritik. Darüber hinaus hat Francis Seeck einen biografischen Bezug zum Thema: Als Kind einer ostdeutschen Arbeiter:innenfamilie hat Seeck selbst oft Klassismus erfahren. Die Live-Aufnahme wird von Simone Glöckler, Aktivistin und Mit-Gründerin von „Frauen* gegen die AfD“ moderiert.
Schlüsselinformationen aus der Folge:
- Klassismus beschreibt die Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft oder gesellschaftlicher Position. Diese Form der Diskriminierung betrifft insbesondere Arbeiterkinder im Bildungssystem, wohnungslose Menschen und Erwerbslose. Klassismus ist oft unsichtbar und wird in Diversitätsdebatten häufig ausgelassen.
- Francis Seeck betont, dass Arbeiterkinder und Menschen aus armutsbetroffenen Familien im Bildungssystem und Arbeitsmarkt zahlreiche Barrieren erleben: Fehlende Netzwerke, eingeschränkte bis keine finanziellen Ressourcen und Vorurteile und Diskriminierung. Seeck plädiert etwa für eine Reform des Schulsystems, indem soziale Herkunft zu oft über den Eintritt in weiterführende Schulen bestimmt.
- Um Klassismus zu überwinden, schlägt Francis Seeck vor, soziale Herkunft stärker in Antidiskriminierungsgesetze zu integrieren und das Schulsystem zu reformieren, um Chancengleichheit zu fördern. Seeck plädiert dabei für mehr Solidarität und offenere Netzwerke. Im Kampf gegen Klassismus ermutigt Seeck Arbeitgeber:innen, Bewerbungsverfahren fairer, standardisiert und somit inklusiver zu gestalten.
Weiterführende Informationen:
Buch: Klassismus überwinden: Wege in eine sozial gerechtere Gesellschaft
Buch: Klassismuskritik und Soziale Arbeit
Weil unser Event herCAREER@Night in dieser Folge thematisiert wird, teilen wir hier transparent unsere Preise:
- für Studierende* 99 € inkl. MwSt.
- Ticket 149 € inkl. MwSt.
- für Dienstleister / Coaches / Trainer:innen** 370 € inkl. MwSt.
- Early Bird ab 10€ / Standard ab 20€
- Studierende und Absolvent:innen besuchen die Messe an beiden Tagen kostenfrei und genießen kostenfreie Anreise mit FlixBus aus dem gesamten Bundesgebiet (solange der Vorrat reicht)
- Trainer:innen und Coaches, HR-Dienstleister:innen ab 90€
Thema
Politik | Gesellschaft
Prof. Dr. Francis Seeck hat die Professur für Theorien und Handlungslehre der Sozialen Arbeit mit Schwerpunkt Demokratie- und Menschenrechtsbildung an der Technischen Hochschule Nürnberg inne. Die forschungsorientierte Professur ist an der Fakultät für Sozialwissenschaften angesiedelt. Seeck forscht und lehrt zu Klassismuskritik, politischer Bildung, Gender und Queer Studies, Antidiskriminierungspädagogik und menschenrechtsorientierter Sozialer Arbeit. Gemeinsam mit Renate Bitzan leitet Seeck das Kompetenzzentrum Gender & Diversity.
Seit 2010 arbeitet Seeck im Feld der Antidiskriminierungspädagogik und Politischen Bildung. Seeck hält Vorträge zu den Themen Klassismuskritik, geschlechtliche Vielfalt und Antidiskriminierung und bietet Fortbildungen dazu an. Francis Seeck wurde 1987 in Ostberlin geboren und lebt aktuell in Nürnberg und Berlin.
Francis Seeck ist Autor*in mehrerer Bücher: „Recht auf Trauer. Bestattungen aus machtkritischer Perspektive“ (2017, Edition Assemblage), „Solidarisch gegen Klassismus. Organisieren, intervenieren, umverteilen“ (2020, Unrast, gemeinsam herausgegeben mit Brigitte Theißl), „Care trans_formieren. Eine ethnographische Studie zu trans und nicht-binärer Sorgearbeit“ (2021, Transcript) und „Zugang verwehrt. Keine Chance in der Klassengesellschaft: wie Klassismus soziale Ungleichheit fördert“ (2022, Atrium). Im März 2024 erschien „Klassismus überwinden. Wege in eine sozial gerechte Gesellschaft“ (Unrast). Im Herbst 2024 erscheint der Sammelband „Klassismuskritik und Soziale Arbeit. Analysen, Reflektionen und Denkanstöße“, den Seeck gemeinsam mit Claudia Steckelberg bei Beltz-Juventa in der Reihe „Diversität in der Sozialen Arbeit“ herausgibt.
Simone Glöckler stellt mit Ausdauer und Begeisterung ihr #Potenzial47plus zur Verfügung, um gemeinsam mit anderen aufzurütteln, anzustoßen, laut zu sein. Um Frauenthemen sichtbar zu machen, wie etwa die Wechseljahre im Bundestag, und um die #NoAfD zurück auf 0 % zu schicken.
So hat sie Anfang 2017 mit weiteren Frauen die „Frauen* gegen die AfD“ gegründet, um die frauenfeindlichen Positionen dieser Partei in ein kritisches Licht zu rücken. Mithilfe einer Socialmedia-Kampagne haben viele Bürger*innen Stellung gegen die AfD bezogen. Nun steht bald wieder eine Bundestagswahl an – und die Ärmel sind dafür im Hochkrempeln-Modus.
Außerdem begleitet Simone die Onlineplattform Palais F*luxx bei deren Kampagnen als Head of Socialmedia und arbeitet beim Fußballverein 1. FC St. Pauli im Verkauf. Zudem ist sie Gründungsmitglied von eeden meets e.V.: der Verein zum Co-Creation-Space eeden in Hamburg.
Der Beitrag wurde im Rahmen der herCAREER Expo 2024 aufgezeichnet und als Podcast aufbereitet.
[00:00:00] Francis Seeck: Klasse wird meistens ausgelassen. In den Debatten ist das immer noch die vergessene Diskriminierungsform. Wenn wir so weitermachen wie bisher, und vor allem klassenprivilegierte Menschen in Führungspositionen in höhere Positionen kommen, dann kommen nicht die Besten in diese Positionen.
[00:00:28] Kristina Appel: Willkommen beim HerCareer Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen? Dann bist du hier genau richtig. Woran denkst du, wenn du „Diversity, Equity und Inclusion“ hörst? An Hautfarbe? Religion? An Gender? Oder vielleicht an soziale Herkunft? Wenn ja, dann bist du beim heutigen Thema: Klassismus. Dr. Francis Seeck ist Professor:in für Soziale Arbeit mit den Schwerpunkten Demokratie und Menschenrechtsbildung. Seeck ist eine der wichtigsten Stimmen in der deutschen Klassismus-Debatte. Sie forscht und lehrt zu Klassismuskritik. In dieser Liveaufzeichnung spricht sie mit Moderatorin Simone Glöckler über Symptome, Gefahren und Lösungsmöglichkeiten von Klassismus in Alltag und Beruf.
[00:01:35] Simone Glöckler: So, herzlich willkommen zum Authors‘ Meetup mit Francis Seeck. Francis ist Professor:in für Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Demokratie und Menschenrechtsbildung und eine der wichtigsten Stimmen in der deutschen Debatte über Klassismus. Du beschreibst Klassismus als eine weitverbreitete, aber oft übersehene Form der Diskriminierung. Erklär uns doch mal bitte: Was ist Klassismus?
[00:02:03] Francis Seeck: Ja, gern. Mich würde auch ganz kurz mal interessieren – vielleicht können alle kurz die Hand heben, die den Begriff Klassismus schon kennen. Tatsächlich ungefähr die Hälfte, würde ich sagen. Also Klassismus beschreibt eine Diskriminierungsform, also ähnlich wie Rassismus oder Sexismus. Bei Klassismus geht es aber um die Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft oder Klassenherkunft und Klassenposition. Also es beschreibt die Diskriminierung insbesondere von Arbeiterkindern im Bildungssystem, die Diskriminierung auch von wohnungslosen Menschen, armutsbetroffenen Menschen, erwerbslosen Menschen. Und ich denke, gerade in München könnt ihr das sicherlich gut beobachten an ganz vielen Stellen. Aktuell sieht man ja auch die Debatte gegen Bürger:innengeldbezieher:innen. Das ist so ein Beispiel von Klassismus. Aber auch im Bildungssystem ist es sehr präsent.
[00:02:59] Simone Glöckler: Was glaubst du denn, woran liegt es, dass wir Klassismus, also diese Form der Ungleichheit, noch gar nicht kennen oder sie noch so unsichtbar ist?
[00:03:07] Francis Seeck: Ja, es wird ja wirklich immer mehr über Diversitätsthemen geredet, aber soziale Herkunft, sozialer Status, Klasse wird meistens ausgelassen. In Berlin gibt es jetzt das Landesantidiskriminierungsgesetz und da wurde sozialer Status mit aufgenommen. Also es passiert ein bisschen was, aber in der Antidiskriminierungsgesetzgebung, in den Debatten ist das immer noch die vergessene Diskriminierungsform. Und das hängt auch damit zu tun, dass es natürlich viel mit Scham zu tun hat. Also armutsbetroffene Menschen wird oft die Schuld gegeben für ihre eigene Situation. Es wird dann gesagt: Ja, du arbeitest nur nicht hart genug. Und auch Arbeiter:innenkinder im Bildungssystem, im Arbeitsleben sind oft auch konfrontiert mit vielen Diskriminierungsformen und auch mit verinnerlichten Vorurteilen. Und das verhindert die Auseinandersetzung. Und natürlich auch, wenn wir uns anschauen: Wer ist denn in der Politik, wer sitzt in Leitungspositionen, wer ist in den Medien auf hohen Positionen? Da sind Menschen, die aus armutsbetroffenen oder Arbeiter:innenfamilien kommen, noch unterrepräsentiert, und deswegen wird das Thema auch selten auf die Agenda gesetzt.
[00:04:16] Simone Glöckler: Jetzt ist es ja so, du bist nicht nur wissenschaftlich tätig in dem Bereich, sondern eben auch Aktivist:in. Also deine persönliche Motivation, sich dem Thema Klassismus zu widmen, magst du uns davon erzählen?
[00:04:29] Francis Seeck: Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich als… Ja, warum nicht? Ich kann auch sagen, auch aktivistisch vielleicht. Oder vielleicht eher im Bereich der Antidiskriminierungspädagogik und politischen Bildung. Da bin ich schon lange tätig. Aber es ist auch mein Lehr- und Forschungsgebiet. Also es ergänzt sich ganz gut. Und ich habe auch einen biografischen Bezug, wie die allermeisten, die zu dem Thema arbeiten. Also ich komme auch aus einer ostdeutschen Arbeiter:innenfamilie, bin in einer armutsbetroffenen Familie aufgewachsen und auch noch in der DDR. Und natürlich habe ich auch an ganz vielen Stellen Klassismus erlebt, also sei es in Bildungsinstitutionen, durch Jobcenter, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und daher ist es auch mein Anliegen. Ich arbeite in der Wissenschaft an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, in der Sozialen Arbeit. Da sind auch ganz viele Studierende, die erst Akademiker:innen sind oder vorher als Erzieherinnen oder Pfleger:innen gearbeitet haben und auch viele Barrieren im Bildungssystem erlebt haben. Daher sind wir da auch permanent in Diskussionen und ich kriege auch viele Einblicke, auch ins bayerische Bildungssystem, aktuell natürlich auch in anderen Bundesländern. Aber ich bin hier an der Hochschule in Nürnberg, daher kriege ich tatsächlich auch viel mit, wie es auch gerade in Bayern läuft.
[00:05:50] Simone Glöckler: Also was ich tatsächlich, ich lasse mich auch von Titeln beeindrucken, muss ich gestehen. Na, du bist jetzt 37, wenn ich mich nicht verzählt habe. Bist Professor, Doktor… Und was mir dann tatsächlich auffiel: Auf dem Buch steht dein Titel nicht und du widmest dich auch zumindest in einem längeren Absatz auch über die Sprache, weil es ist wahnsinnig verständlich geschrieben und ich habe keinen hohen Bildungsgrad, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe es sofort verstanden, wovon du redest, was du angefangen hast, was du verbessern willst. Steckt da eine Absicht dahinter, also auch deinen Titel nicht aufzuzeigen? Und du hast ja auch von einer Professorin oder Dozentin was zu hören bekommen mit der einfachen Sprache.
[00:06:33] Francis Seeck: Erst mal danke für das Feedback. Es freut mich immer, wenn Leute sagen: Ach, endlich mal ein Buch, was man gut lesen kann, weil tatsächlich sehr viele Wissenschaftler:innen ja nicht in verständlicher Sprache sprechen. Gerade in Deutschland, also im englischsprachigen Raum ist das noch mal ein bisschen anders. Da gibt es eine andere Kultur. Aber in Deutschland denken Leute immer, sie müssten möglichst kompliziert schreiben, weil es angeblich eine besondere Intellektualität oder sonst was darstellen würde. Und mir ist es wichtig, mit meiner wissenschaftlichen Arbeit und Antidiskriminierungsarbeit, dass sie auch breit verständlich ist. Sie richtet sich auch nicht nur an Menschen in der Wissenschaft, sondern auch an Menschen in der Politik, in der sozialen Arbeit, im Kulturbetrieb, auch in der Wirtschaft. Und daher ich möchte hier verstanden werden mit dem, was mein Anliegen ist. Und mit den Titeln: Ja, ich bin da so ein bisschen flexibel, würde ich sagen. Also ich brauche jetzt nicht überall meinen Titel ran machen, der steht jetzt auch nicht auf meinem Klingelschild oder sonstwo. Aber es ist manchmal auch ganz gut, den Titel zu nutzen, gerade für diese Themen. Also weil ihr euch sicherlich vorstellen könnt, also in Bayern sind beispielsweise 82 Prozent der Professuren mit Männern besetzt und bei unserem neu berufenen Treffen der bayerischen Professor:innen, da steht man dann schon in einer Masse von weißen Männern plus 50 im Anzug und, ja, ich werde schon sehr oft auch als Student:in angesprochen, also auch von männlichen Kollegen. Und ich glaube, einige brauchen auch wirklich immer eine Zeit, weil viele Studierende der Sozialen Arbeit sind ja auch ein bisschen älter, und dann brauchen die wirklich eine Zeit, um zu realisieren, dass man eine Professur hat. Und ich habe auch eine forschungsorientierte Professur. Also in Bayern gibt es jetzt zunehmend über die High-Tech-Agenda diese Forschungsprofessuren, wo man weniger Lehre hat und eine bessere Ausstattung, wissenschaftliche Mitarbeiter:innen. Und die sind fast ausschließlich oder mehrheitlich auch mit Männern besetzt, auch mit älteren Männern. Daher mit den Titeln: Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo ich gerade bin und was ich damit erreichen möchte. Manchmal nutze ich die auch, aber die müssen jetzt nicht überall draufstehen.
[00:08:52] Simone Glöckler: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass so Titel eben auch Türöffner sind, um dann eben auf ein Thema aufmerksam zu machen. Klassismus ist ja tief in der Gesellschaft verwurzelt, auch noch unsichtbar. Und jetzt sind wir ja hier auf der HerCareer, was ja eine Messe ist, die sich um Arbeit, Karriere und Netzwerken kümmert. Viel Empowerment, aber man hat ja auch in der Arbeitswelt mit Klassismus, also nicht nur in der Bildung, was dem widmest du ja auch Aufmerksamkeit in deinem Buch, aber in der Arbeitswelt, das ist ja dann nochmal und sicherlich auch bei dir, also im universitären Bereich, ein Thema. Wie ist denn da der Stand? Also ich wollte jetzt gerade sagen, wie schlimm ist es in der Arbeitswelt. Aber erzähl doch mal!
[00:09:41] Francis Seeck: Also gibt ja oft „Diversity Days“ oder „Diversitätstage“. Aber das Thema soziale Herkunft, sozialer Status wird auch immer noch komplett ausgeblendet. Und natürlich in der Arbeitswelt: Es prägt auch die Klassenposition ganz viele Bereiche. Also wir haben erst drüber gesprochen, Bewerbungsgespräche, hat man jemand, der die Bewerbung gegenlesen kann? Kleidung kann auch sehr teuer sein. Welche Regeln kennt man, welche nicht? Manche Menschen lassen sich ja auch sehr beeindrucken von einem gewissen Auftreten. Also da haben wir den Fachbegriff in den Sozialwissenschaften: Habitus. Wie spricht man, was verkörpert man, in welcher Klasse fühlt man sich zugehörig? Da gibt es ja auch in der Arbeitswelt ganz bestimmte Regeln, um höhere Leitungspositionen zu bekommen. Und es ist sehr geprägt, ich meine, hier bei der Messe, ich habe das heute erst erfahren und war tatsächlich recht schockiert, dass hier dieses Networking-Dinner fast 200 Euro kostet. Also dass man 200 Euro zahlen kann, um dann in einen exklusiven Bereich reinzukommen, um sich dann bessere Chancen zu erkaufen. Sozusagen ein Bewerbungsverfahren. Das ist ja aus einer Diversitätsperspektive, wenn wir auf soziale Herkunft schauen, wirklich tragisch, weil dadurch Bewerber:innen, die es sich leisten können, zum einen das zu bezahlen, die 200 Euro, und zudem auch sich wohlfühlen bei so einem Netzwerk-Dinner, auch was die Kleidung angeht und Auftreten, Gesprächsdialoge. Also ich bin immer gegen solche Sachen. Ich mach bei so was auch tatsächlich eigentlich nie mit, bin da auch selbst nie. Also diese ganzen Netzwerkveranstaltung sind aus der Perspektive von Klassismus und sozialer Herkunft sehr kritisch zu betrachten.
[00:11:31] Simone Glöckler: Ja, ich finde die Kritik auch berechtigt. Und wenn wir das schon kritisieren, also du hast es kurz angerissen, ein Auswahlverfahren, also wie könnte es aussehen oder was können auch Arbeitgeber:innen oder Unternehmen tun, um ein Auswahlverfahren, ein Bewerbungsverfahren so niedrigschwellig und so wenig elitär oder exklusiv wie möglich zu machen?
[00:11:53] Francis Seeck: Ja, also ich mache ja auch regelmäßig Auswahlverfahren. Also bei uns sind ja auch immer wieder Stellen ausgeschrieben und was uns zum Beispiel wichtig ist, dass man den eigenen Lebenslauf wirklich auch mit Brüchen darstellen kann und uns auch Berufserfahrungen außerhalb der Wissenschaft oder außerhalb von irgendwelchen prestigeträchtigen Kontexten interessiert. Und auch Bewerber:innen, die zum Beispiel länger in der Pflege tätig waren oder in anderen Bereichen, dass das ein sehr großer Pluspunkt ist im Bewerbungsverfahren und wir diese Berufserfahrung auch jenseits von Wissenschaft auch viel Raum geben und versuchen, dass die Bewerbung, ja dass es da eine Vielfalt von Biografien geben kann und bei kostenlos… – unbezahlt, nicht kostenlos – es gibt auch sehr viele unbezahlte Praktika, die Leute machen und dass uns das auch sehr bewusst ist, dass das jetzt nicht so viele Punkte erhält, sondern auch viel aussagt über die Herkunft der Bewerber:innen. Und da einen genaueren Blick darauf zu richten, warum wird jetzt ein unbezahltes Praktikum in der deutschen Botschaft Kolumbien so viel besser bewertet wie jahrelange Erfahrung als Pflegerin? Also da genauer hinzuschauen. Und auch Rechtschreibung zum Beispiel und Grammatik finde ich jetzt nicht so ausschlaggebend. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die das dann direkt aussortieren, nur weil jemand irgendwelche Rechtschreib- und Grammatikfehler drin hat, auch ein bisschen bei der Form, etwas mehr Flexibilität und natürlich immer in Auswahlverfahren sollte man halt sehr stark schauen, also wir wissen aus der Forschung, dass man oft Leute fördert, die einem sehr ähnlich sind, was soziale Positionierung angeht. Und ja, wenn wir uns zum Beispiel die Hochschullandschaft anschauen, in Bayern oder in Deutschland die Wissenschaftslandschaft, da sitzen halt vor allem Leute aus Akademikerfamilien, aus klassischen, privilegierten Familien, viele weiße Personen auf Professuren oder in der Hochschulleitung und auch viele Männer, Cis-Männer, und dass man da dann wirklich schaut im Bewerbungsverfahren, sich gegenseitig auch ein kritisches Feedback zu geben, also die Auswahlkommission so divers wie möglich zu gestalten und sich auch auf die eigenen Leerstellen hinzuweisen, warum man eigentlich wen passend oder sympathisch findet. Zu schauen, inwiefern das einfach die eigene Positionierung spiegelt.
[00:14:31] Simone Glöckler: Du hast ja nun auch einen für mich tatsächlich auch sensationellen Weg selber hingelegt. Aber wie können wir denn jetzt bzw. Arbeiter:innenkinder gestärkt werden, eben sich auch zu bewerben und es und nicht aufzugeben und trotzdem weiterzumachen? Und wenn von mir aus auch erst mal nicht die Intelligenz erkannt wird, weil irgendwelche anderen Dinge wichtiger sind. Also was können wir hier tun, um das so niedrigschwellig wie möglich zu halten, also auch so im Umgang?
[00:15:02] Francis Seeck: Wir sind ja erst so ein bisschen bei diesem Abendessen hängen geblieben und ich glaube, diese ganzen informellen Sachen, also Mittagessen, Abendessen, diese ganzen Netzwerkräume sind schon ein wichtiger Punkt für Klassismuskritik oder der Ort, wo sich soziale Herkunft dann am meisten zeigt. Also genau in diesen Kontexten, und da würde ich wirklich dafür plädieren, wegzugehen von Orten, wo dann ein besonderer Knigge erforderlich ist oder bei der Arbeitskleidung. Zu versuchen, zum einen mehr Transparenz zu schaffen, zum anderen da eine größere Offenheit für unterschiedliche Stile, und auch zu schauen, worüber wird geredet, was sind die Gesprächsthemen auch in den Pausen bei Netzwerkevents? Und natürlich ist es immer schön, wenn sich Leute in Leitungspositionen trauen, auch ein bisschen was zu ihrem eigenen Weg zu erzählen, also über ihre eigene Biografie zu sprechen. Das macht ganz viel, weil ich das jetzt wirklich auch in meinen Bewerbungsausschreibungen gesehen habe, dass ich sehr viele Bewerbungen bekomme und auch vor allem von Menschen, die sich vorher nicht beworben haben. Also auch ganz viel von Menschen, die Mehrfachdiskriminierung erfahren, die einen anderen Bildungsweg haben und die das dann auch aktiv reinschreiben. Und es wird ja auch manchmal behauptet, ja, die bewerben sich einfach nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch schon mal gehört habt, aber das hör ich im Wissenschaftskontext oft, ja, wir wollten ja hier mehr Diversität schaffen, aber es hat sich niemand beworben. Und als ich jetzt in meine Bewerbung, also als wir die gesichtet haben, da war ganz viel Diversität auch zu erkennen an Bildungsbiografien, Klassen, Herkünfte, auch bezogen auf Rassismuserfahrung, viele auch queere Perspektiven. Also es hängt schon sehr davon ab, wer da in die Professuren und Leitungspositionen kommt. Um noch mal zu diesem Netzwerk-Dinner zurückzukommen, weil ich es jetzt einfach sehr gebasht habe, aber was ich vielleicht machen würde, also ich bin nicht prinzipiell dagegen. Also so eine Messe ist natürlich sehr voll und laut und man kann sich nicht gut unterhalten. Deswegen finde ich prinzipiell die Idee, noch mal einen ruhigeren Rahmen zu schaffen zum Austausch, gut. Aber ich würde dann dafür plädieren, vorab zum Beispiel kurze Motivationsschreiben, also dass man sich bewerben kann und auch auf Diversitätsfaktoren eingeht, warum es wichtig ist und dann kein Teilnahmebeitrag gefordert wird, sondern eine Auswahl auf eine andere Art, also die Auswahl nicht über Geld, sondern über eine kleine Bewerbung, Motivation, so würde ich das zum Beispiel regeln.
[00:17:33] Simone Glöckler: Dein Buch heißt ja „Klassismus überwinden“. Und das wäre eben auch eine Form tatsächlich, es so niedrigschwellig wie möglich zu halten. Es ist, wie gesagt, der Titel deines Buches. Es ist ja aber auch der Untertitel „Wege in eine sozial gerechtere Gesellschaft“. Hast du konkrete Ansätze oder Strategien, wie wir dem beikommen können? Oder als zweite Frage: Was kann denn die Politik tun? Du hast das Antidiskriminierungsgesetz schon angesprochen, aber gäbe es da noch mehr Möglichkeiten oder was eben deine Ansätze, es zu überwinden, sind?
[00:18:08] Francis Seeck: Also ich hab viele Ideen, die ich jetzt nicht alle ausführen kann, weil es ja wirklich um alle gesellschaftlichen Bereiche geht. Aber im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz müsste soziale Herkunft, sozialer Status stärker verankert werden. Dann müssen wir das Schulsystem noch mal grundsätzlich reformieren, weil die meisten Arbeiter:innenkinder und Schüler:innen aus armutsbetroffenen Familien werden schon nach der Grundschule ausgesiebt und erhalten keinen Zugang zum Gymnasium. Und das liegt eben nicht an ihrer Leistung, sondern wir wissen, dass Arbeiter:innenkinder eine höhere Leistung erbringen müssen wie Kinder aus privilegierterem Hintergrund, um eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Sie müssen zum Beispiel eine höhere Lesekompetenz vorweisen. Das ist auch eher ein Thema, was auch für die Wirtschaft interessant ist, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, und vor allem klassenprivilegierte Menschen in Führungspositionen, in höhere Positionen kommen, dann kommen nicht die Besten in diese Position, weil wir das eben wissen, auch aus der Forschung, dass die Ärmeren selbst bei höherer Leistung diskriminiert werden. Und man sollte auch das Schulsystem in Bayern, es ist ja wirklich auch noch extrem mit der Aussiebung, hier spielt dann auch Rassismus noch sehr mit rein. Man sollte eigentlich eine Schule für alle etablieren und diese Dreigliedrigkeit auflösen. Und natürlich, es ist generell so, dass die Löhne im Niedriglohnsektor auch angehoben werden sollten und viel im Kontext sozialer Abfederung noch verändert werden muss.
[00:19:44] Simone Glöckler: Nun, es sieht es ja leider in Deutschland so aus, dass wir nicht unbedingt in eine wirklich rosige Zukunft steuern. Ich spreche jetzt auch die Bundestagswahl nächstes Jahr [2025, d. Red.] an, dadurch, dass es politisch und auch im Antidiskriminierungsgesetz noch gar nicht verankert ist. Und jetzt male ich mal das Bild ein bisschen schwarz: Angenommen, die AfD erhält so viel Macht, die würde ja als allererstes unter Umständen das Antidiskriminierungsgesetz abschaffen. Das ist natürlich auch ein Thema in der Klassismusforschung, die große Kraft, die die Rechten entwickeln in unserer Gesellschaft, und eben jetzt auch politisch. Was können wir denn da tun?
[00:20:21] Francis Seeck: Ja, es ist erstmal wichtig, auch in deren „sozialpolitisch“ – weil die haben da eigentlich gar kein richtiges Programm – aber da mal reinzuschauen, weil die eigentlich alles abschaffen wollen, also Grundsicherung, Bürger:innengeld, das soll alles gekürzt werden. Am besten, sie stellen sich das eigentlich so vor, dass die Frauen alle wieder zu Hause bleiben, sich um die Care-Arbeit und um den ganzen sozialen Bereich kümmern. Soziale Arbeit kann man eigentlich fast abschaffen, weil das machen dann ja wieder die Frauen, die nicht mehr lohnarbeiten sollen. Und die haben also kein überzeugendes sozialpolitisches Programm, die wollen da einfach radikal alles runterkürzen. Und Klassismus ist ja auch bei Rechtspopulist:innen und in der extremen Rechten sehr verankert. Es gab ja im Nationalsozialismus auch den „schwarzen Winkel“, unter dem sogenannte asoziale Menschen verfolgt und ermordet wurden und unter der Aktion „Arbeitsscheu Reich“ auch in Konzentrationslager gebracht wurden. Also Begriffe wie „arbeitsscheu“ oder „asozial“, das sind auch Begriffe, die aus dem Nationalsozialismus kommen. Und es gibt regelmäßig Hassverbrechen, Morde an wohnungslosen Menschen, an langzeiterwerbslosen Menschen von der extremen Rechten. Und die haben ein sehr klassistisches Weltbild, was sich vor allem gegen armutsbetroffene Menschen richtet und Menschen, die nicht ins System passen. Die versuchen jetzt immer zu spalten, die sozusagen Arbeiterklasse gegen die sogenannte Unterschicht oder Menschen, die Sozialleistungen beziehen, und verkaufen sich aber teilweise als Partei, die angeblich sich für Arbeiter:innen einsetzt. Ich glaube, da kann man ganz viel Gegenrede machen und auch mal ins Parteiprogramm gucken, Fakten sammeln. Und gerade im Wirtschaftsbereich kann man auch viel gegen die AfD machen und sich da engagieren.
[00:22:17] Simone Glöckler: Ich habe Ende 2016 mit anderen Frauen in Hamburg die „Frauen gegen die AfD“ gegründet. Zum einen, weil Donald Trump Präsident wurde und uns ehrlich gesagt – und verzeiht den Ausdruck – der Arsch auf Grundeis ging, dass ein Sexist und Nationalist Präsident wurde. Und dann stand ja die Bundestagswahl 2017 an! Daraufhin haben wir uns gegründet und haben eine Kampagne gestartet. Und inzwischen ist es so, dass wir darüber nachdenken, unseren Namen zu ändern. Weil es ist nicht mehr nur die AfD, die die Frauenrechte massiv einschneiden möchte und eben auch die, ich sage mal noch, regierenden Parteien, ja auch gerade was Klassismus betrifft oder Arbeiter:innen. Also ich spreche es jetzt mal aus: Die FDP ist auch keinen Deut besser, was das betrifft, bei diesen Diskriminierungsformen, und von dem Kanzlerkandidaten einer großen Partei möchte ich vielleicht mal gar nicht reden. Und ich versuche jetzt tatsächlich mit meinen Mitstreiter:innen die Wirtschaft mit ins Boot zu holen. Ich werde mich auch vernetzen mit Frauen, auch aus Ostdeutschland, weil ganz häufig heißt es ja noch: Na ja, die wären irgendwie schuld dran und die machen ja auch nichts. Doch, die tun was. Nur wir kriegen es einfach nicht mit. Und dass wir zumindest, und wir sind 50 Prozent dieser Gesellschaft, Frauen zusammen kriegen, dass sie zumindest schon mal wählen gehen oder sich Gedanken machen. Man kann sicherlich sagen, ich bin konservativ, das darf ja auch jemand sein. Aber man kann nicht eine Politik wählen, die behinderte Kinder wieder in Lager sperren möchte. Und deshalb ist mir das so ein wichtiges Thema. Und die noch regierenden Parteien oder die regierenden Parteien, die benutzen halt auch diese Sprache inzwischen. Na, du hast vorhin das Bashing gegen Bürger:innengeldbezieher:innen angesprochen. Das kommt ja nicht nur von der AfD, so wie wir sie jetzt benennen, sondern eben auch aus den Parteien, die in der Regierung sitzen. Und da war ja auch die Frage: Was können wir tun? Jetzt habe ich tatsächlich auch ein bisschen Zeit, mich zu engagieren. Aber was können wir alle tun? Also, das war auch so die Frage, die ich gestern in einem Meetup gestellt habe. Und es ist tatsächlich so: Wir haben, wir leiden nicht unter einer Politikverdrossenheit, sondern unter einer Parteienverdrossenheit. Wir müssen einfach Politikerinnen und Politiker dazu animieren, einfach auch mal eine Vision zu erstellen. Eine positive Vision, weil Deutschland ist eines der reichsten Länder. Wir können es uns erlauben, tatsächlich auch solche Themen groß zu behandeln. Aber wie stellen wir es an? Da habe ich noch keine Antwort. Auch wahrscheinlich bis heute Abend nicht. Aber wie gesagt, wir werden uns da weiterhin drum bemühen tatsächlich. Was ich eine spannende Frage, die du aufgeworfen hast in deinem Buch, dass ihr bitte alle lesen müsst, ist: Wer spricht über Klassismus? Das fand ich total spannend, dass dann auf irgendwelchen Panels, ob die divers besetzt sind, was das Geschlecht betrifft, sei jetzt mal dahingestellt, aber es meist überhaupt nicht klassismusbetroffene Menschen sind, die darüber sprechen. Wo kommen wir denn da hin, dass auch klassismusbetroffene Menschen darüber sprechen?
[00:25:16] Francis Seeck: Ja, es mir immer ein wichtiges Anliegen und es gibt total viele Gruppen und Bündnisse und gerade #Ichbin armutsbetroffen, den Hashtag habt ihr vielleicht mal mitbekommen. Da gibt es auch Ortsgruppen und auch eine deutschlandweite Vernetzung. Und die sind immer ansprechbar für Podien. Auch die Selbstvertretung wohnungsloser Menschen, mit denen ich auch immer viel zusammenarbeite. Und es gibt auch Arbeiterkinder-Referate an Hochschulen, zum Beispiel auch hier in München, an der LMU. Da gibt es ein Referat von studierenden Arbeiterkindern, die sich zusammengeschlossen haben, sich austauschen über Erfahrungen, aber auch Veranstaltungen organisieren. Und eigentlich freuen sich immer alle über Einladungen. Ich versuche immer, wenn ich für Podien eingeladen bin, auch zu sagen: Hey, wir sollten auch Leute noch einladen aus der Selbstorganisation. Da kommen manchmal – oder oft kommen zu Kommentare nach dem Motto: Sind Sie denn überhaupt podiumsfest? Kann man…? Also da gibt es gewisse Ängste und auch Vorurteile, die sich aber – und ich habe sehr viele Veranstaltungen zusammen organisiert mit Menschen aus diesen Gruppen, die auch viel dazu schreiben, publizieren, forschen, und würde nur dazu ermutigen, vielleicht mal zu schauen, ich weiß nicht, aus welchen Orten ihr überall seid, aber das ihr immer schaut im Netz. Also wen gibt es da so? Gibt es eine Erwerbsloseninitiative, gibt es eine Wohnungsloseninitiative? Ansonsten kann man auch mit Einrichtungen der sozialen Arbeit, zum Beispiel der Paritätische Wohlfahrtsverband, die machen auch viel zu dem Thema oder auch zu Strukturen, oder Arbeiterkind e.V. zusammenarbeiten.
[00:26:57] Simone Glöckler: Vielen Dank erst mal bis hierhin. Gibt es jetzt Fragen von euch? Moment..
[00:27:03] Zuhörerin: Ich bin Cora, ich arbeite im Personal viel, deswegen kenne ich die ganzen Themen recht gut. Und was mir oft begegnet, ist, dass es Menschen gibt, die es wie du geschafft haben, raus sozusagen aus dem System und eine Erfolgsgeschichte erzählen, was auch schön ist. Andererseits bedient das ja wieder dieses Narrativ: Jeder kann es schaffen. Deutschland bietet den Boden dafür, jeder kann es schaffen. Wie kommen wir da zu einer Erzählung, wie schwer das doch tatsächlich eigentlich ist, und zu einer Erlebbarkeit für privilegierte Menschen, sag ich mal, wie mich als weiße Frau, wie ich erleben kann, was für einen Struggle Menschen haben, ohne dass es aber zu so einer, also wie soll ich sagen, dass es eine Vorführung oder so ist, weil ich glaube, es braucht viel mehr diese Geschichten, damit Menschen wirklich bewusst ist, wie schwer das ist. Und dieser tagtägliche Struggle, wenn ich vom Bürgergeld lebe und eine neue Waschmaschine mir kaufen muss, was das bedeutet. Da ist irgendwie gefühlt keine Sichtbarkeit, empfinde ich.
[00:28:04] Francis Seeck: Ja, danke für die Frage. Also da habe ich zwei Gedanken dazu. Zum einen ist es wichtig, dass alle über ihre Klassenherkunft nachdenken oder ihre soziale Herkunft. Also dass alle mal überlegen, wo kommen sie eigentlich her? In welchen Einkommensverhältnissen sind sie aufgewachsen, in welchen Vermögensverhältnissen, welche welches kulturelle Kapital, welche Bildungsabschlüsse hatte das Elternhaus, und sich, gerade wenn man selbst Bewerbungsverfahren durchführt, auch mal zu reflektieren: Was ist eigentlich die eigene Klassenherkunft? Und sie prägt einen, wen man sympathisch findet, wen nicht, mit welchen Vorannahmen man da reingeht. Und ich finde, es sollte viel mehr über Klasse gesprochen werden und Klassenherkunft, und dass aber auch alle darüber sprechen, nicht nur Arbeiter:innenkinder. Ich hatte vor ein paar Tagen einmal eine Fortbildung, wo eine Kunstlehrende, also Kunstprofessorin, dann mal reflektiert hat, welche Privilegien sie schon alle von ihrem Elternhaus mitbekommen hat. Also schon ein Cello als Kind, ganz viel kulturelles Kapital, ganz viele Netzwerke, und die das für sich erkannt hat und jetzt natürlich auch in ihrem beruflichen Schaffen dann ganz anders damit umgehen wird, und bei uns, die dann immer vorgeführt werden als ja, dann ist es ja der Beweis, dass es möglich ist, es zu schaffen. Da ist es immer wichtig, dass wir dann noch mehr aufmerksam machen, dass wir es trotz der ganzen Diskriminierungserfahrung geschafft haben, aber wir wirklich Ausnahmen sind. Und da kann man ja dann auch auf die Forschungsergebnisse verweisen, die ja auch deutlich machen, dass für die allermeisten es eben keine Möglichkeit ist, und also eher auf die ganzen Barrieren noch mal hinzuweisen und nicht sich auch als Erfolgsgeschichte zu präsentieren, sondern den Raum, den man bekommt, zu nutzen, um auf Ungleichheit aufmerksam zu machen.
[00:29:59] Simone Glöckler: Vielen Dank.