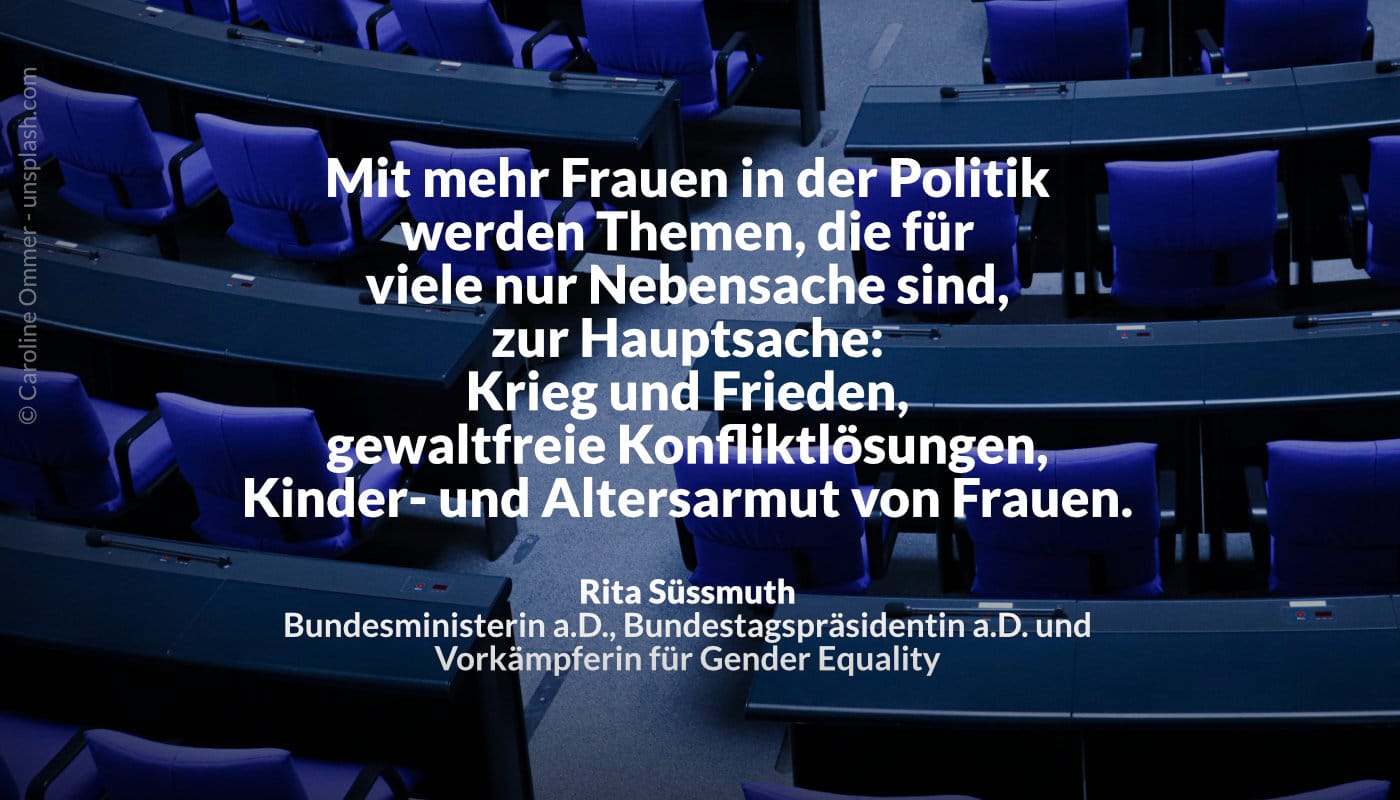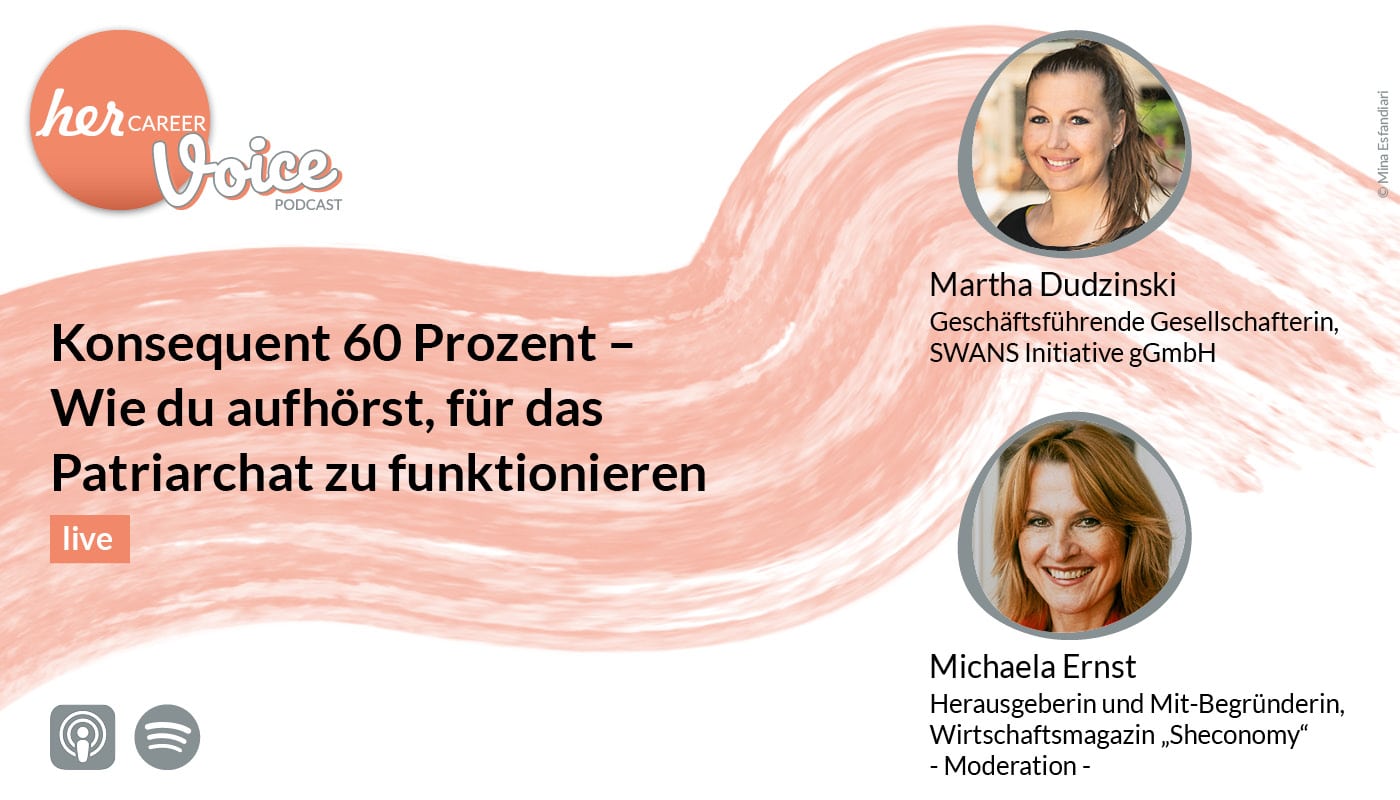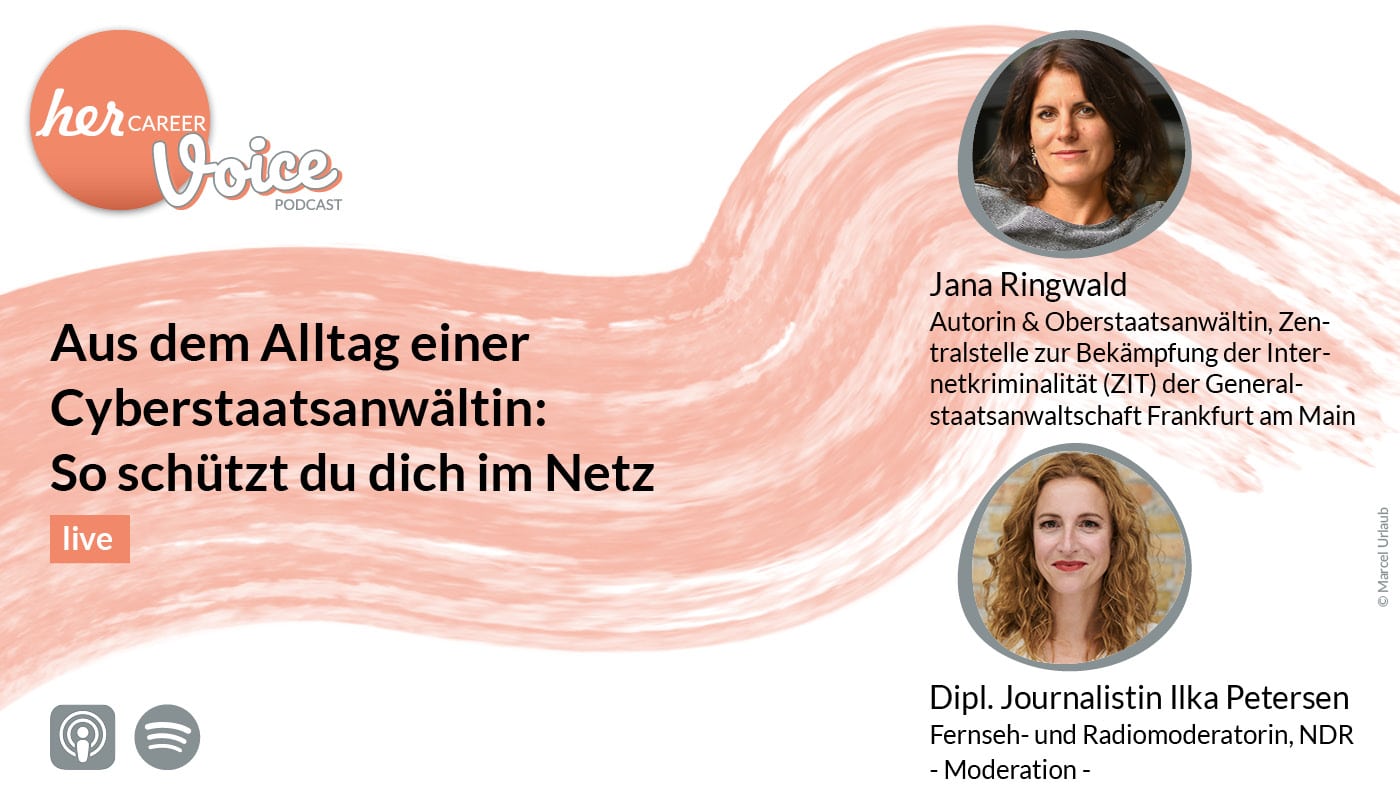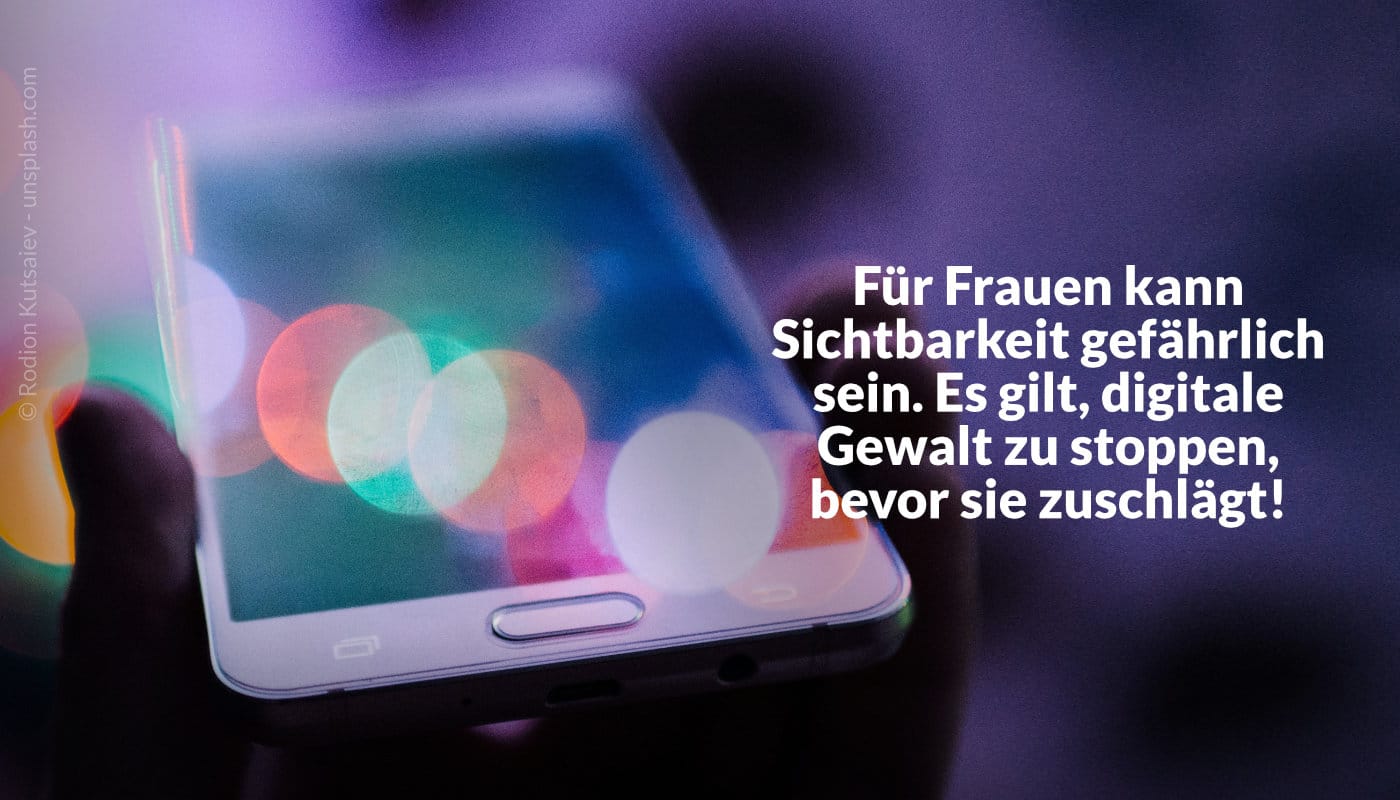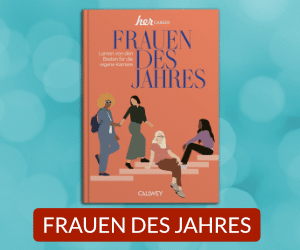Was bedeutet ein neues Ostbewusstsein für eine gemeinsame deutsche Zukunft?
Valerie Schönian ist Journalistin bei der ZEIT in Leipzig und Autorin des Buches „Ostbewusstsein. Warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die Deutsche Einheit bedeutet“. Im Live-Gespräch mit Moderatorin und Gründerin Isabell Hoyer – übrigens selbst Ostdeutsche – erklärt Valerie, was sich für sie hinter dem Begriff „Ostbewusstsein“ verbirgt.
Nämlich:
- sich der eigenen ostdeutschen Herkunft bewusst zu werden,
- ein Selbstbewusstsein mit dieser Herkunft zu entwickeln
- und die Aufforderung, sich bewusst als Ostdeutsche zu positionieren.
“Ostbewusstsein ist Identität, Selbstbewusstsein und eine bewusste Entscheidung, ostdeutsche Perspektiven sichtbar zu machen.”
Wie werden Nachwendekinder eigentlich zu Ossis?
„Ich will nicht über Charaktereigenschaften reden, ich will nicht Klischees reden”, sagt Schönian. ”Ich will über Strukturen reden, und darüber, dass man an allen sozioökonomischen Daten immer noch die innerdeutsche Grenze nachziehen kann.“ So gibt es in ostdeutschen Bundesländern immer noch weniger Eigentum, deutlich weniger Erbschaften und demnach weniger Unternehmertum, weniger Risikobereitschaft, weniger Chancen.
Für eine vereinte Zukunft baut Valerie Schönian vor allem auf die Ostdeutsche Zivilgesellschaft. Ihre Vision für eine echte deutsche Einheit:
- Unterschiede sichtbar zu machen und zu diskutieren, um daraus zu lernen – nicht nur für Ostdeutsche, sondern auch für Westdeutsche.
- die ostdeutsche Perspektive stärker einbringen und für den Osten zu streiten.
- Unterschiede zwischen Ost und West anzuerkennen und sie nicht als trennend, sondern als bereichernd zu begreifen. Nur so kann der Einigungsprozess vorankommen.
- die aktuelle Situation im Osten ernst zu nehmen, das Misstrauen in die demokratischen Institutionen zu verstehen und die ostdeutsche Zivilgesellschaft, die sich für Demokratie einsetzt, zu unterstützen.
Was das auf wirtschaftlicher, politischer und persönlicher Ebenen beinhaltet, hörst Du in dieser Folge.
Thema
Politik | Gesellschaft
Angaben zur Referentin
Valerie Schönian ist 1990 in Gardelegen, Sachsen-Anhalt, geboren und aufgewachsen in Magdeburg. Studiert hat sie in Berlin, ausgebildet wurde sie an der Deutschen Journalistenschule in München. Danach machte sie für einen Jahr das Blogprojekt „Valerie und der Priester“, ging anschließend zur ZEIT, zunächst als Redakteurin für das Leipziger Büro, dann als Autorin. Ihre Bücher „Halleluja. Wie ich versuchte die katholische Kirche zu verstehen“ (2018) und „Ostbewusstsein. Warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die Deutsche Einheit bedeutet“ (2020) erschienen im Piper-Verlag. Sie lebt als freie Autorin in Berlin.
Angaben zur Moderatorin
Isabelle Hoyer ist eine Gründerin und Unternehmerin, die sich seit über zehn Jahren für Gleichstellung und Vielfalt in der Arbeitswelt einsetzt. Mit Employers for Equality bieten sie und ihr Team Unternehmen ein einzigartiges Diversity-Bildungsprogramm an und arbeiten dafür mit den renommiertesten Diversity-Expert*innen zusammen. Als Mitbegründerin des PANDA Women Leadership Network schafft Isabelle mit ihrem Team eine Plattform für Austausch und Vernetzung für aktuell über 4000 weibliche Führungskräfte. Als Beraterin für Unternehmen, die ihre Kultur verändern wollen, um
Chancengleichheit für alle Mitarbeitenden zu schaffen, steht sie im engen Austausch mit Unternehmen, moderiert Panels oder inspiriert als Rednerin. Als Mutter zweier erwachsener Kinder liegt Isabelle auch das Thema Bildung, die Schaffung moderner Arbeitsumgebungen und das Aufzeigen starker Vorbilder am Herzen. Isabelle kommt ursprünglich aus Dessau und lebt seit vielen Jahren mit ihrer Familie in der Nähe von München.
Der Beitrag wurde im Rahmen der herCAREER Expo 2024 aufgezeichnet und als Podcast aufbereitet.
[00:00:00] Valerie Schönian: Ich glaube nicht, dass es irgendein Politiker oder Politikerin böse meint, aber da ist offensichtlich teilweise so eine Blindheit immer noch für einige ostdeutsche Gegebenheiten vor Ort. Es geht hier nicht nur darum, die ostdeutsche Seele zu streicheln. Es geht halt immer um Machtfragen. Es geht darum, wer kriegt wie viel vom Kuchen in diesem Land. Und das muss man halt immer wieder sichtbar machen.
[00:00:29] Kristina Appel: Willkommen beim HerCareer Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen? Dann bist du hier genau richtig. Wie werden Nachwende-Kinder eigentlich zu Ossis? Und was bedeutet ein neues Ostbewusstsein für eine gemeinsame deutsche Zukunft? Valerie Schönian ist Journalistin bei der „Zeit“ in Leipzig und Autorin des Buches „Ostbewusstsein. Warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die Deutsche Einheit bedeutet“. Im Livegespräch mit Moderatorin und Gründerin Isabelle Hoyer, selbst Ostdeutsche, erklärt Valerie, was sich für sie hinter dem Begriff Ostbewussein verbirgt. Sie ordnet außerdem die Erfolge und den Einfluss der AfD in ihrer Heimat ein, und erklärt, warum sie ihre Hoffnungen nicht in Medien und Politik setzt, sondern stattdessen auf die ostdeutsche Zivilgesellschaft baut.
[00:01:43] Isabelle Hoyer: Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr und Sie alle da seid. Ich bleibe glaube ich beim ihr, weil die allermeisten Gesichter kommen mir irgendwie eh bekannt vor. Mein Name ist Isabelle Hoyer. Ich freu mich wahnsinnig, dass ich dieses Buchgespräch hier moderieren darf mit Valerie Schönian. Und es wird jetzt in den nächsten 35 Minuten um das Buch „Ostbewusstsein. Warum Nachwende-Kinder für den Osten streiten und was das für die Einheit bedeutet“ gehen. Und da freue ich mich sehr drüber, und Valerie Schönian ist ein Kind des Ostens, ich glaube man kann das so sagen, in Gardelegen 1990 geboren. Wir sind Landsfrauen, das heißt wir kommen beide aus Sachsen-Anhalt, hat Politikwissenschaft studiert und Germanistik in Berlin, danach die Deutsche Journalistenschule in München besucht und ist heute Journalistin für „Die Zeit“, für das Zeitbüro in Leipzig und Autorin dreier Bücher mittlerweile. Und wir sprechen heute über dieses Buch. Ostbewusstsein. Zwei, drei Worte zu mir, nicht weil ich über mich so viel reden möchte, aber weil wir eine interessante Konstellation haben. Wie gesagt, ich komme selbst auch aus Sachsen-Anhalt, bin zwölf Jahre älter und wir haben schon im Vorgespräch festgestellt, dieser Altersunterschied, der spielt ja bei dem Thema, über das wir sprechen – Ostbewusstsein, was hat das eigentlich heute noch für eine Bedeutung? – wirklich eine sehr, sehr große Rolle, weil ich zum Beispiel meine Grundschulzeit noch in der DDR verbracht habe, während du, Valerie, nach dem Mauerfall geboren bist. Das finde ich einen besonders interessanten Aspekt. Mich würde interessieren, wer aus dem Publikum kommt denn aus dem Osten? Es sind doch einige, aber es ist gemischt. Und zu dem Thema spricht man, vielleicht erlebst du das, auch oft vor ostdeutschem Publikum. Deshalb finde ich es heute besonders spannend, dass wir hier wirklich Hälfte-Hälfte haben. Aber wir steigen ein mit der Frage: Dein Buch heißt Ostbewusstsein. Und meine Frage ist, was meinst du denn damit eigentlich?
[00:03:37] Valerie Schönian: Ja, hallo auch von mir, ich freue mich, dass ich da sein kann. Ostbewusstsein, ich meine damit so drei verschiedene Sachen. Also auf der einen Seite so eine Bewusstwerdung, die auch bei mir stattgefunden hat, so, ich komme aus Ostdeutschland. Also anders als vielleicht bei dir war mir das ganz lange gar nicht bewusst, eben weil ich nicht in der DDR groß geworden bin, sondern ich bin aufgewachsen in Magdeburg und in dem Bewusstsein dass dieses Land aus 16 Bundesländern besteht und Ost und West, das waren für mich Himmelsrichtungen. Und die DDR, das war Geschichte wie das Römerreich, abgeschlossen und vorbei. Und das heißt, ich meine, mit dieser Bewusstwerdung, ich komme aus dem Osten. Dann dieses Selbstbewusstsein, es ist auch voll okay und sogar gut, dass ich aus dem Osten komme. Weil das wird ja auch ganz vielen immer ganz oft abgesprochen. Und im dritten Schritt dann auch so eine Aufforderung, es ganz bewusst auch zu sein. Also du hast ja gerade gesagt, ich bin in München zur Journalistenschule gegangen. Ich wurde hier ja gar nicht als Ossi betitelt. Also niemand hat mich so geframed, sondern ich musste mir das quasi selbst aneignen. Das war so zu der Zeit 2014, als so Pegida losging, die AfD im Osten stärker wurde das erste Mal und dann alle Leute oder Medien ganz viel plötzlich wieder vom „dem Osten“ die Rede war. Und ich so dachte, ich mich angesprochen gefühlt hatte, obwohl ich ja gar nichts damit zu tun hatte und mir das auch irgendwie so erobern musste. Und damit man diese Vorurteile so aufsprengt, meine ich damit auch diese Aufforderung, ganz bewusst aus dem Osten zu sein. Hier sind offensichtlich ganz viele Leute aus dem Osten, die nicht in diese Vorstellung von komischer Dialekt und Runenschrift-Pulli passen. Ich finde die ostdeutschen Dialekte toll. Eine Sache vielleicht noch, ich finde schon, deswegen nutze ich auch sehr gerne den Begriff Ostbewusstsein. Ich meine damit, dass auch Westdeutsche Ostbewusstsein haben können. Also es geht nicht darum, dass man jetzt unbedingt ost-sozialisiert sein muss, sondern um dieses Bewusstsein, dass die ostdeutschen Perspektive immer noch teilweise eine anderes ist als die westdeutsche, sich immer noch unterscheidet und halt auch gesehen werden muss.
[00:05:36] Isabelle Hoyer: In deinem Buch irgendwo steht hier: Je länger die Mauer nicht mehr da ist, desto stärker wird eigentlich dieses Ostbewusstsein. Und wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, ich kann da anknüpfen, weil ich selbst auch erst seit so, keine Ahnung, vier, fünf Jahren irgendwie stärker darüber nachdenke, stärker reflektiere. Was hat das für Auswirkungen gehabt für mein heutiges Leben? Was meinst du damit? Woran glaubst du, liegt das, dass je mehr Zeit verstreicht, das Thema offensichtlich irgendwie für dich persönlich eine größere Relevanz bekommt, aber ja auch in der medialen Diskussion gerade wieder eine riesengroße Relevanz hat und in meiner persönlichen Wahrnehmung sogar eine größere als, weiß ich nicht, vielleicht zehn Jahre nach dem Mauerfall.
[00:06:17] Valerie Schönian: Ich glaube, auf der einen Seite ist der Osten durch die politischen Begebenheiten, Realitäten, dadurch, dass dort Rechtsradikale und rechtsextreme Kräfte teilweise immer mehr politische Macht erhalten, immer mehr Thema geworden. Und wenn dann plötzlich so von „dem Osten“, immer wieder von Ostdeutschland allgemein, die Rede ist in den Medien, aber meistens oder ganz oft, so war es zumindest einige Jahre lang immer nur in der Kombination mit irgendwie AfD und Rechtsextremismus. Was natürlich wichtig ist, dass man darüber redet, also ich will nicht beschönigen, was irgendwie da gerade passiert teilweise, aber der Osten ist natürlich viel, viel mehr als nur das. Und ich glaube, das hat bei vielen Leuten und auch bei mir zu so einem Gefühl zuerst geführt. Also so einer Leerstelle, so einer Irritation. Irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas fehlt, aber ich kann noch nicht richtig in Worte fassen, was das eigentlich ist und dann ging so, ich nenne es meine Ossi-Werdung los. Und das Ding ist natürlich an so Identitäten: Die sind ja nicht so anfassbar wie so ein Tisch, die kann man nicht zeigen, sondern Identitäten entstehen ja, weil wir darüber reden. Also die sind durchaus real, weil daran eben Ressourcen hängen und Macht hängt und so weiter. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto bewusster wird einem das. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, ich arbeite jetzt vor allem oder größtenteils damit, wird mir natürlich klar, wie viele Fäden meines ganz persönlichen Lebens daran hängen, dass ich Ostdeutsche bin.
[00:07:40] Isabelle Hoyer: Und was meinst du damit? Was sind das für Fäden, die daran hängen?
[00:07:43] Valerie Schönian: Also ich meine einerseits natürlich historisch, ja. Ich bin jetzt hier aus, ich wohne in Berlin, im Westberlin sogar. Ich bin nach München gefahren. Ich arbeite als Journalistin in einer freien Presselandschaft. Ich bin mit einem westdeutschen Mann verheiratet. Die Hälfte meines Freundeskreises ist aus Westdeutschland. Mein Leben wäre natürlich völlig anders, wäre diese Geschichte irgendwie anders verlaufen. Und dann meine ich damit aber auch die strukturellen Unterschiede. Ich werde ganz oft gefragt, ich bin jetzt schon seit einigen Jahren mit dem Thema unterwegs und gerade in Westdeutschland, auch von westdeutschen Journalisten, Journalistinnen, werde ich dann ganz schnell sehr gerne gefragt, was ist denn jetzt so eine typisch ostdeutsche Charaktereigenschaft, sagen Sie mal. Und ich sage dann, ne, ich will nicht über Charaktereigenschaften reden, ich will nicht über Klischees reden, Ich will über Strukturen reden, also ich will darüber reden, dass man an allen sozioökonomischen Daten beispielsweise ja immer noch die innerdeutsche Grenze nachziehen kann, also um das konkret zu machen auf meine Generation. Ich habe Freunde in Berlin, die leben jetzt mit Anfang 30 in Eigentumswohnungen, die ihre Eltern ihnen bezahlt haben. Ich saß so mit 24 das erste Mal bei der privaten Altersvorsorge, um mich da irgendwie so drum zu kümmern. Ich meine, gerade Erbe ist ja ein riesiges Ding. Also ich glaube, gerade in Bayern und Süddeutschland allgemein wird viel mehr vererbt als in Ostdeutschland. Es ist einfach kein Thema in Ostdeutschland. Du kannst da einfach, was sollst du da vererben jetzt in meiner Generation? Das weißt du ja auch, da ist ja nichts da. Das wirkt sich natürlich total auf mein Leben aus und auf das Leben aller Nachwendekinder, aller Ostdeutschen, wie du deine Lebensentscheidung triffst, ob du zum Beispiel auch mal ins Risiko gehst, in ein Unternehmen kommst, wenn du in Sicherheit gehst. Das könnte man anhand aller Themen irgendwie so durchdeklinieren. Was aber auch ich sehr wichtig finde, ist die Erkenntnis, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten die politische Macht, die wirtschaftliche Macht, die historische Haupterzählung, die mediale Macht, dass das alles immer noch sehr westdeutsch geprägt ist, ja. Und dass es deswegen auch so wichtig ist, dass wir das sichtbar machen, aufzubrechen, um halt so ein Bewusstsein zu schaffen und auch mehr Ostdeutsche in Führungspositionen zu bringen, zum Beispiel.
[00:09:49] Isabelle Hoyer: Jetzt sagtest du gerade, deine eigene persönliche Ossi-Werdung. Da würde mich interessieren, gerade auch so zum Generationenthema, wie wurde denn die in deiner Familie zum Beispiel aufgenommen?
[00:10:00] Valerie Schönian: Also als ich meinen Vater eröffnete, Papa, ich bin jetzt wieder ostdeutsch, was hältst du davon? Da sagte der so, was hast du noch mit dem Osten zu tun? Und daraufhin entspann sich, das ist vor einigen Jahren jetzt schon gewesen, 2019 oder 2018. Und da entspann sich so eine mehrstündige Diskussion in unserem Esszimmer mit meinem Bruder, 97 geboren, mit meinen Eltern. Wo ich dann irgendwie alle Vorurteile so aufgezählt habe, denen ich hier auch in München begegnet bin. Und dadurch ist das ja auch gekommen, meine Ossi-Werdung, weil ich gemerkt habe, einige Klischees, von denen ich dachte, die wären noch ein Klischee, dass es die gibt, dass die wahr sind. So, dass Leute plötzlich von Ossi und Jammer-Ossi reden hier in München. Und ich dachte, wo kommt das denn jetzt her? Und das habe ich ihm alles erzählt und er meinte trotzdem die ganze Zeit: Nein. Nein. Nein. Spielt einfach keine Rolle. Da saß da so eine Totalverweigerung aller Schönian-Papa so. Und irgendwann habe ich dann aber von so einer 14-Jährigen erzählt, die da damals in unserer Redaktion Praktikum gemacht, die war aus Leverkusen, und die hat erzählt, was sie in der Schule lernen über Ostdeutschland. Nämlich, die haben keine Bananen und die dopen alle. Und daraufhin wurde es dann halt so drei…
[00:11:10] Isabelle Hoyer: Und das war jetzt zeitgenössisch?
[00:11:13] Valerie Schönian: Ja, genau. Da wurde es ein paar Sekunden, sehr lange Sekunden so sehr, sehr still bei uns im Esszimmer und dann fing mein Vater an: Das erzählen die immer noch, oder was?! Die müssten mal herkommen, hier ist es bunter als da! Er hat sich in so eine Wutrede so rein manövriert und da hatte ich das Gefühl, ich habe ihn überzeugt, dass es irgendwie noch Probleme gibt. Ich wusste da aber erst mal gar nicht, finde ich das jetzt eigentlich gut oder nicht, weil er war so in dem die Modus, wo ich ihn ja gar nicht haben will. Also ich will ja nicht spalten. Also im Gegenteil. Und dann war ich auch so, kann ich mich damit beschäftigen? Aber ich habe mich dafür entschieden, also ich bin zum Schluss gekommen, dass das geht.
[00:11:52] Isabelle Hoyer: Und was war die Motivation dafür, wenn du sagst, ich will nicht spalten? Was möchtest du denn mit deinem Buch?
[00:11:58] Valerie Schönian: Auf der einen Seite geht es mir um diese Sichtbarmachung, was ich gerade schon erzählt habe. Also diese Sichtbarmachung davon, was im Osten passiert ist, von der Geschichte, von der Perspektive. Also diese andere Perspektive, die, das kann man eben so durchdeklinieren, durch verschiedenste Punkte, sich unterscheidet historisch, die sich unterscheidet so strukturell. Also in Westdeutschland leben so viele Menschen wie noch nie, in Ostdeutschen leben so viele Menschen wie 1905. Das wirkt sich natürlich komplett auf das Leben aus und auf die Lebenszufriedenheit und auch den Blick und so. Das muss man ja irgendwie wissen und auch beispielsweise, wenn politische Fördertöpfe vergeben werden, passiert es immer wieder, dass Bundesgelder vergeben werden mit einem so… dass der Eigenanteil der Kommunen relativ hoch sein muss. Das ist für Bayern super. Bayern kann das dann sozusagen alles abgreifen. Viele ostdeutsche Kommunen können das teilweise nicht. Also da ist offensichtlich, ich glaube nicht, dass es irgendein Politiker oder Politikerin böse meint, aber da ist teilweise so eine Blindheit immer noch für einige ostdeutsche Gegebenheiten vor Ort. Und das muss man halt immer wieder sichtbar machen. Und was mir aber halt auch sehr wichtig ist… Es geht hier nicht nur darum, die ostdeutsche Seele zu streicheln. Also es geht auch nicht darum zu sagen, dass Rotkäppchen-Sekt der tollste Sekt der Welt ist (was er ist). Oder „Kling Klang“ von Keimzeit bekannt zu machen, was alle kennen sollten. Sondern es geht halt immer um Machtfragen. Es geht halt darum, wer kriegt wie viel vom Kuchen in diesem Land. Und deswegen ist es halt immer wieder wichtig, darüber zu reden. Aber halt auch für Westdeutschland. Es geht jetzt nicht nur um die Ostdeutschen, sondern Westdeutschland kann lernen von Ostdeutschland. Erstens von der ganzen Transformationserfahrung, gerade beim Thema Frauen. Als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, wollte die Feministin in mir manchmal ihren Kopf gegen die Wand schlagen, wenn ich darüber nachgedacht habe, wie weit wir hätten sein können, wenn man damals mehr aus dem Osten übernommen hätte bei der Wiedervereinigung. Kein Vorwurf, das war ein schneller Prozess. Ich hätte es vielleicht nicht besser gemacht, aber da muss man darüber reden, um sozusagen davon zu lernen. Also dadurch, dass die Wiedervereinigung ja immer noch ein Prozess ist, können wir ja immer noch voneinander lernen, das ist ja das Tolle, also ist ja nicht vorbei. Ich bin auch immer dafür, dass wir halt zurückschauen, um halt natürlich nach vorne zu kucken. Und ich finde aber auch sehr wichtig, dass wir ernsthaft miteinander reden, also dass hingeschaut wird von Westdeutschland nach Ostdeutschland, um jetzt auch die politischen Gegebenheiten sich anzugucken und zu sagen, was können wir denn da lernen. Weil was immer wieder passiert, auch nach den Landtagswahlen, jetzt auch nach der Europawahl, ist, dass so getan wird, als sei die AfD ein rein ostdeutsches Problem. Die Probleme mit der AfD sind da, drängende sogar. Ein Faschist ist stärkste Kraft geworden in Thüringen, daran ist nichts schön zu reden, aber viele Entwicklungen, die im Osten zu der starken AfD führen, gibt es halt auch in Westdeutschland. Deswegen wird die AfD ja auch in Westdeutschland immer stärker. Sie ist ja in Hessen zweitstärkste Kraft, in bayerischen Kommunen, wo es keinen Systemumbruch gibt, liegt sie ja auch bei fast 30 Prozent teilweise. Das muss man halt verstehen, um sich das anzukucken, um als Gesamtdeutschland irgendwie zu lernen, was ist denn jetzt unsere Antwort darauf? Weil wenn die Demokratie, wie wir sie kennen, im Osten scheitert, wird sie überall scheitern, weil der Westen in ganz vielen Entwicklungen immer nur so ein bisschen hinterher zieht. Also, dass Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus auch ein größeres Problem sind und nicht nur ein ostdeutsches, sehen wir ja auch an der europäischen Entwicklung und teilweise globalen, das heißt, mich ärgert dann immer schon nach den Wahlen, wenn so getan wird, wir tun das jetzt so auf dem Osten ab. Also nicht nur, was mich ärgert als Ostdeutsche, sondern weil ich es so verdammt gefährlich finde. Ich glaube, die meisten Westdeutschen haben jetzt schon vielleicht hoffentlich verstanden, dass da historisch nicht alles ideal gelaufen ist oder zumindest einiges hätte anders laufen können. Aber wir müssen dadurch, dass es politisch grad dringlich ist, ganz, ganz viele Sachen auf einmal machen. Also ja, man muss da schon alles verstehen, aber wir müssen schon auch noch gleichzeitig kucken, was passiert denn da gerade, weil es passiert gerade ganz viel. Also die AfD hat ja schon total viel politische Macht, also es ändern sich gerade in Behörden, in Medien und so weiter, so Denkweisen, dass die AfD jetzt schon Druck ausübt, dass Leute sich nicht mehr teilweise trauen, ihre Meinung zu sagen, ja. Das passiert schon. Da muss man jetzt hinschauen und nicht halt von oben herab, sondern sich connecten, um eine Antwort zu finden.
[00:15:52] Isabelle Hoyer: Was für Reaktionen hast du denn von Ost und West auf dein Buch erhalten? Hast du da einen Unterschied festgestellt?
[00:15:59] Valerie Schönian: Ja, ich habe auch von Westdeutschen Reaktionen bekommen, aber ich glaube, die allermeisten, die es gelesen habe, sind Ostdeutsche, vor allem Ostdeutsche meiner Generation, hatte ich das Gefühl. Also von denen kam halt so ganz viel positives Feedback und so: Aha, danke! Also Dinge, die mich sehr gefreut haben. Aber interessanterweise waren die ersten zwei Rezensionen von älteren weißen Herren, einer aus Westdeutschland, einer aus Ostdeutschland, die waren so negativ, der eine meinte, hat kritisiert, Valerie Schönian schafft es, Plattenbauten schön zu finden. Ja, ich finde nämlich Plattenbauten schön, da steht da drin, warum. Und das war dann so die Kritik und dass ich so gendern würde und so.
[00:16:38] Isabelle Hoyer: Also es ging nicht um die Sache.
[00:16:40] Valerie Schönian: Genau. Aber ich glaube so, aus unserer Generation, aus meiner Generation, haben das sehr viele sehr positiv aufgenommen und gesagt, ah ja. Was ich jetzt merke, das Buch ist ja schon ein paar Jahre alt, dass daraus so neue Dinge entstehen. Es gibt zum Beispiel Olivia Schneider, die ist die „Ostfluencerin“. Ich empfehle jedem bei Instagram ihren Kanal, die macht ganz tolle Sachen.
[00:17:03] Isabelle Hoyer: Alle zücken ihre Handys. Sag den Namen noch mal.
[00:17:06] Valerie Schönian: Olivia Schneider, die „Ostfluencerin“, die hat zum Beispiel mein Buch gelesen. Sie Meinte, ohne das Buch wäre vielleicht der Account gar nicht entstanden. Also es sind so Dinge dadurch entstanden, was mich freut. Aber auch viele Westdeutsche, ein paar Mal war ich ja schon in Westdeutschland damit unterwegs habe, haben auch immer positiv und offen reagiert.
[00:17:27] Isabelle Hoyer: Warum sind es aus deiner Wahrnehmung, vielleicht nicht nur aber schon auch, viele Nachwendekinder, die jetzt das Thema für sich entdecken und was hat das für die heute im Prinzip noch für eine Relevanz, woran machen wir eigentlich heute noch fest, wer ist denn eigentlich ostdeutsch?
[00:17:40] Valerie Schönian: Ich glaube, die Frage, wer ist eigentlich ostdeutsch, die ist halt super kompliziert natürlich. Und bei mir ist es so, ich will das niemandem absprechen. Also, wenn sich eine west-sozialisierte Person nach Ostdeutschland bewegt und nach ein, zwei Jahren sagt, ich fühle es, ich bin Herzens-Ossi, ich war es schon immer, ich bin ostdeutsch, dann sage ich: Cool, go for it, alles gut. Also, man sollte sich natürlich dann damit auseinandersetzen, was da halt alles passiert ist, aber… Also jede Studie definiert das anders und es gibt Studien, nach denen Angela Merkel keine Ostdeutsche wäre, weil sie in Hamburg geboren ist. Also man kann das nicht so ganz hart festmachen, aber trotzdem ist natürlich wichtig, dass wir darüber reden, dass es auch diese Studien gibt, weil es trotzdem ganz oft um Voraussetzungen geht. Also wer hatte denn die Voraussetzung – Erbe habe ich schon als Schlagworte angesprochen. Wer hatte denn da? Eher Westdeutsche. Wie gesagt, es geht immer um… es gibt ja auch Westen Arbeiterkinder, die hatten natürlich auch jetzt wahrscheinlich kein großes Erbe, aber was sind denn die Voraussetzungen, mit denen ich so ein bisschen ins Leben gestartet bin, was ich sozusagen gar nicht unbedingt dann nach Wohnort festmachen muss, wenn du mit ostdeutschen Eltern nach Westdeutschland geflogen bist, aber die hatten keinerlei Erbe für dich, bist du in dem Fall vielleicht eher ostdeutsch geprägt. Wenn du dann aber gleichzeitig in deinem Umfeld zig Unternehmen hattest, wo du in den Sommerferien einen Job machen kannst für 3.000 Euro, während im Ostdeutschland irgendwie alle kellnern gehen müssen, für 5 Euro, bist du da eher westdeutsche geprägt, ne? Also das ist, glaube ich, wir sind da so ein bisschen hybride auch. Und ich glaube, viele haben das Bedürfnis, ihre eigene Geschichte auch sichtbar zu machen. Also ich bin ja sehr viel mit dem Thema unterwegs und alles, was ich gerade so gesagt habe, erlebe ich so bei vielen, so dieses Bedürfnis, was verteidigen zu wollen und was richtigstellen zu wollen und halt aber auch das Bedürfnis, also jetzt was zu tun, damit die Situation nicht kippt.
[00:19:28] Isabelle Hoyer: Dieses für den Osten Streiten. Man könnte ja auch sagen, ich will ihn bekannt machen, ich will in den Osten einladen, ich will für den Osten werben. Du hast dich aber entschieden zu sagen, ich will streiten für den Osten. Warum, glaubst du, müssen wir so sehr streiten?
[00:19:42] Valerie Schönian: Ich glaube, dass gerade auch in meiner Generation, also ich bin ja jetzt, ich habe mich ja in eine privilegierte Situation vorgearbeitet, sage ich mal. Ich darf hier so sitzen, ich darf davon erzählen, ich werde gehört, ich bin Journalistin und das hatten ja meine Eltern noch gar nicht. Unsere Elterngeneration und Großelterngeneration. Also wenn man sich so den medialen Diskurs ankuckt der 90er Jahre, wie da über Ostdeutsche geredet wurde, also da möchte man auch nochmal seinen Kopf an die Wand schlagen, das ist unerträglich so. Es gab einfach nicht so viele, die für den Osten sich einsetzen konnten, und das ist glaube ich unsere Generationen erst, auch, weil mir zum Beispiel ja schon gar nicht irgendwie Ostalgie vorgeworfen werden kann. Also es wird schon versucht, aber dann lache ich laut auf, weil ich bin, also Entschuldigung, was hab ich denn mit der DDR zu tun? Und ich aber schon finde, genau, man muss dafür streiten, weil es einfach noch so viele Gegenwind gibt. Also für mich war halt eher so die Frage, muss man eigentlich kämpfen? Aber das finde ich so kriegerisch. Und außerdem finde ich, dass wir generell als Gesellschaft Streiten wieder lernen können. Also irgendwie haben wir alle Streiten verlernt. Also ich schließe mich da gar nicht aus. Ich hoffe, ich bin dabei, es wieder zu lernen. Ja, man packt sich so schnell in irgendwelche Schubladen, anstatt so gegenseitig mal auszuhalten, rechts wie links, und zu sagen, okay, hier ist unser demokratischer Verfassungsboden, darauf streiten wir, aber dann halt auch zu streiten für alle, die den verlassen, und zu sein, nee, wir streiten für unsere Demokratie.
[00:21:08] Isabelle Hoyer: Du betonst das Ostbewusstsein, die ostdeutsche Herkunft, das ist auch was, was ich häufig betone, weil wir selbst immer wieder auch in solchen Diskussionen sind, ja, und aus ganz ähnlichen Motiven, wie die du genannt hast. Und trotzdem frage ich mich dann häufig, mein Sohn ist 2000 geboren, zehn Jahre jünger als du, zufällig noch in Dessau geboren, wirklich nur, weil wir gerade da waren, aber hier aufgewachsen. Ich habe ihn auch mal gefragt, was bedeutet das dann eigentlich für dich in deiner Firma? Kriegt ihr das irgendwie mit? Und der sagt: gar nichts. Und deshalb ist die Frage, was bedeutet das für die deutsche Einheit, da habe ich mich an der Stelle gefragt, wenn ich das immer wieder sozusagen betone, tue ich da was für die deutsche Einheit oder betone ich das vielleicht sogar irgendwie über, gehe ich eigentlich in eine andere Richtung, wo ich sage, eigentlich sollten wir doch schon viel weiter sein und wirklich als Einheit agieren? Was bedeutet es denn für die deutsche Einheit, über Ost und West sich auseinander zu setzen?
[00:22:01] Valerie Schönian: Ich finde, wir sind eine Einheit. Wir haben eine deutsche Einheit, also ganz offensichtlich. Man kann halt einmal so in irgendein juristisches Dokument kucken, keine Ahnung, und dann findet man das halt raus. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich fahre jetzt in ein anderes Land. Ich besuche meine älteste Freundin morgen in Stuttgart, also da habe auch nicht das Gefühl, wir leben in einem anderen Land. Also wir sind eine Einheit, eine deutsche Einheit. Ich finde nur, da gibt es eben Probleme, über die wir reden müssen. Aber ich finde, ich betone das gerade nochmal, weil… Ich glaube, dass viele nicht darüber reden wollen, weil sie dann denken, okay, wir reden über Ost und West, immer noch. Dann hat das mit der Einheit nicht funktioniert. Wann sind wir denn mal fertig? Und ich glaube, da darf so ein Umdenken stattfinden. Entschuldigung, wir haben gerade erst angefangen, darüber zu reden. Wir werden immer darüber reden. Aber es ist okay. Wir können darüber reden in einem perfekt wiedervereinigten Land. Das ist kein Problem. Und es gibt ja auch die Bayern. Also ich meine, Markus Söder beharrt mehr darauf, dass Bayern irgendwie anders ist, als Ostdeutsche das bei sich tun. Und trotzdem kommt keiner auf die Idee, da zu fragen, ist das eine Einheit, Bayern und der Rest des Landes? Das ist natürlich historisch gewachsen. Verstehe ich ja auch alles. Aber ich glaube, da darf so ein Umdenken stattfinden, damit halt auch… Das ist ein ganz banaler Fakt, der mir immer immer so sehr, sehr wichtig ist. Also es einfach schaffen, das zu verstehen als Gesellschaft, dass Unterschiede nichts trennendes sein müssen, sondern was Bereicherndes sein können. Also, dass wir einfach über Ost und West reden können und trotzdem ein perfekt wiedervereinigtes Land sind, und dass es sogar so ist, dass, weil wir jetzt mehr darüber reden als vor einigen Jahren noch, dass wir auf einem guten Weg sind in Sachen Wiedervereinigung, die ich trotzdem gleichzeitig als Prozess sehe, weil wir, die wir jetzt kritisieren, in Positionen sind, in denen wir auch gehört werden. Also, es gibt die These des sogenannten Integrationsparadoxons vom Soziologen Aladin El-Maafalani. Und der sagt, dass man immer denkt, wenn es Streit in einer Gesellschaft gibt, dann denkt man, man driftet irgendwie auseinander. Aber das Gegenteil ist halt der Fall. Man wächst eigentlich zusammen. Also weil die Probleme waren halt schon immer da, alle über die wir jetzt gesprochen haben. Aber das haben die meisten Westdeutschen einfach gar nicht mitbekommen. Weil wie denn? Und jetzt machen wir ein bisschen Stress und sorgen dafür, dass es hoffentlich immer mehr hören.
[00:24:11] Isabelle Hoyer: Ich schaue mal ins Publikum. Wir haben noch so circa zehn Minuten. Wer hat denn eine Frage oder gerne auch vielleicht eine Anmerkung?
[00:24:18] Zuhörerin: Das passt vielleicht ganz gut auch dazu: meine Mutter ist im Osten geboren und mein Vater kommt aus Westdeutschland, das heißt, ich bin so ein bisschen Kind der Wiedervereinigung. Und was bei mir in der Familie häufig passiert ist, dass die westdeutsche Familie die ostdeutschen Familie abgewertet hat. Und ich glaube, das hat gesellschaftlich auch ganz, ganz viel stattgefunden. Und wenn wir auf Frauenrechte zum Beispiel gucken, gab es viele Dinge, die im Osten besser funktioniert haben und bei der Wiedervereinigung und ich würde nicht sagen, dass wir ein wiedervereintes Land sind. Tatsächlich würde ich es ein bisschen radikaler formulieren, dass viele Dinge, die im Osten waren, weil es war der schlechte Sozialismus, das war das schlechtere Wirtschaftssystem und der Westen hat alles viel besser verstanden und das wurde aufgedrückt und gesellschaftlich findet der Diskurs teilweise immer noch statt. Und dieses Wiederzurückholen des Begriffes Ossi und den positiv aufwerten, was vor allem junge Leute machen gerade in Ostdeutschland, finde ich sehr sehr wichtig. Die politische Ausrichtung, die auch teilweise in Ostdeutschland passiert, liegt nicht an den ehemaligen DDR-Bürger:innen grundsätzlich nur, sondern hat auch viel mit Bewegung von sehr rechten westdeutschen Bürger:innen zu tun, die in den Osten gegangen sind und leer stehende Dörfer aufkaufen. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass es nicht zu sehr vermischt werden darf, dieser politische Punkt und dann auch gleichzeitig diese Frustration von Menschen, die in der DDR groß geworden sind.
[00:25:38] Valerie Schönian: Also dieser letzte Punkt mit der Gleichzeitigkeit, den finde ich ganz wichtig. Also wir sind halt wirklich gerade in einer politischen Lage, wo ganz viel auf einmal passieren muss. Also auf der einen Seite finde ich, vielleicht schließe ich das auch nochmal an die erste Anmerkung an, braucht es so ein Verständnis für so Wut und Emotionen so gegenseitig. Ich finde, so genau wie Sie sagen, es braucht mehr Verständnis für die Wut. Aber ich verstehe natürlich auch jede Person, die sich einzeln angegriffen gefühlt hat und so sagt, Entschuldigung, ich mach doch gar nichts, und da auch ein Verständnis zu haben. Also generell einfach mehr Verständnis in der Gesellschaft und das Aufarbeiten, was da passiert ist und so weiter. Aber wir müssen halt auch echt gucken, was jetzt gerade in Ostdeutschland passiert, das ist wirklich echt ernst. Was es auch braucht, ist, wenn wir jetzt über den Osten reden und darüber reden, dass der Westen auch Osten ernst nehmen muss, jetzt nicht nur historisch zu gucken, sondern zu schauen, was passiert jetzt gerade in diesem Moment. Also, wenn ich vielleicht ein Beispiel nennen kann, was mir sehr wichtig ist, weil ich bin ja Autorin vom Leipziger Büro der „Zeit“, ich bin da die ganze Zeit unterwegs, und was ich erlebe, ist, dass das Misstrauen in demokratischen Institutionen sehr, sehr, also immer geringer wird, oder bei vielen, nicht bei allen, bei einigen Menschen sehr gering ist. Die Frage ist, wie bekommt man diese Menschen eigentlich davon überzeugt, dass die Demokratie eine tolle Sache ist? Medien, etablierte, werden in diesen Bereichen kritisch gesehen. Parteien, Politiker verlieren immer mehr Vertrauen. Die einzige Hoffnung, würde ich sagen, die größte Hoffnung ist die ostdeutsche Zivilgesellschaft, die demokratische und die gibt es. Die wird immer nicht so erwähnt, aber die ist da und die meisten Menschen, die sozusagen gegen Rechtsextremismus kämpfen im Osten, die sind im Osten. Und die Frage ist, wie unterstützt man die jetzt eigentlich? Und es ist wirklich, wenn man sich damit beschäftigt, dann möchte man auch wieder den Kopf gegen die Wand schlagen, weil es bräuchte zum Beispiel das Demokratieförderungsgesetz. Das würde dafür sorgen, dass die ostdeutsche Zivilgesellschaft unterstützt werden kann vom Bund, ohne dass die Kommunen zustimmen. Fast in allen Kommunen ist mittlerweile die AfD stärkste Kraft. Die AfD hat vor, das zu blockieren. Das ist kein Geheimnis. Die hat das schon versucht. Und wenn dieses Demokratieförderungsgesetz nicht kommt, dann fehlt staatlich Geld für die Zivilgesellschaft. Kann man sagen, kann von anderen Ecken kommen, und da ist wieder, deswegen komme ich dahin, diese Blindheit für die ostdeutsche Perspektive. Im Osten gibt es viel weniger Geld. 90 Prozent der ostdeutschen Unternehmen haben weniger als zehn Mitarbeiter. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da gibt es viel weniger Geld von Unternehmen. 7 Prozent der Stiftungen sitzen in Ostdeutschland. Ich finde es wichtig, sich jetzt mit der ostdeutschen Zivilgesellschaft zu connecten und zu sagen, nicht von oben herab, sondern erstens, um zu lernen, weil alle Entwicklungen können auch in Westdeutschland passieren. Und zweitens, zu supporten, weil die Zivilgesellschaft braucht Geld und Sichtbarkeit.